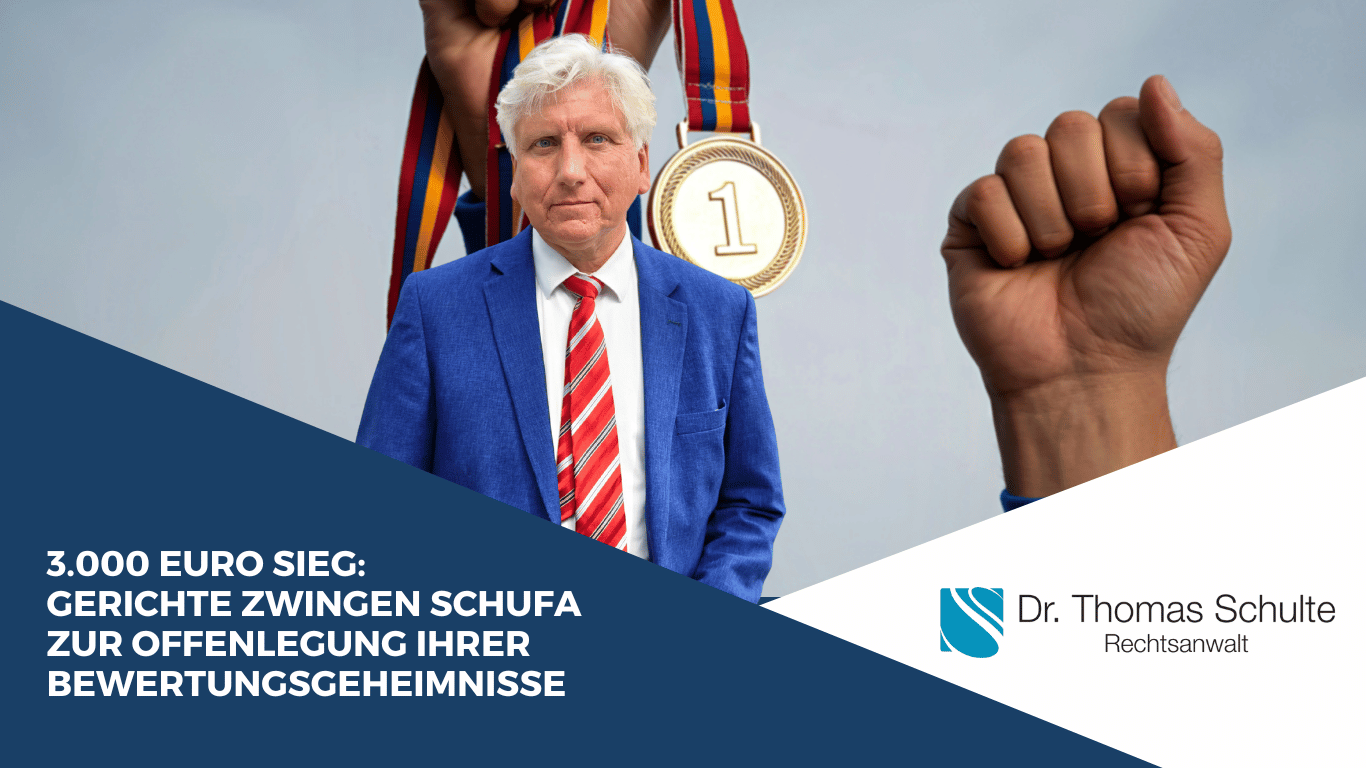Wie transparent ist die Schufa wirklich und wer schützt uns vor einem Algorithmus, der über Kredite, Wohnungen und Chancen entscheidet? Was, wenn Gerichte endlich mehr Licht ins Dunkel bringen und der digitale Score seine Allmacht verliert? Die Offenlegung von Daten zur Bewertungskriterien?
Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Bayreuth sorgt für Aufsehen: Einer Verbraucherin wurden 3.000 Euro Schadensersatz zugesprochen, weil ihr SCHUFA-Score nicht nachvollziehbar zustande kam und dadurch mehrere Kreditentscheidungen negativ beeinflusst wurden. Der Fall ist kein Einzelfall, sondern reiht sich in eine wachsende Zahl gerichtlicher Auseinandersetzungen rund um die Score-Berechnung ein. Immer häufiger landen diese Fälle vor deutschen Gerichten. Der Trend ist eindeutig: Verbraucherrechte gewinnen an Gewicht. Rechtsgrundlage für diese Entwicklung sind zentrale Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere Artikel 15 und 22.
Diese Normen verpflichten datenverarbeitende Unternehmen wie die SCHUFA, Betroffenen umfassend Auskunft über gespeicherte Informationen und die Art ihrer Verarbeitung zu geben. Genau das war im vorliegenden Fall nicht geschehen. Die Klägerin hatte mehrfach versucht, die Grundlage ihrer Score-Berechnung zu verstehen – vergeblich. Weder die Herkunft der Daten noch deren Verknüpfung wurde transparent dargelegt. Das Gericht urteilte: Diese Intransparenz sei nicht nur ein Verstoß gegen Datenschutzrechte, sondern habe auch einen messbaren wirtschaftlichen Schaden verursacht.
Der Fall erhält zusätzliches Gewicht durch zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs. In der Rechtssache C-634/21 stellte der EuGH klar, dass algorithmisch berechnete Wahrscheinlichkeiten in ihrer Wirkung wie Entscheidungen zu werten seien – und somit unter Artikel 22 DSGVO fallen. Das bedeutet: Jede automatisierte Bewertung muss entweder durch eine ausdrückliche Einwilligung oder durch eine transparente und menschlich nachvollziehbare Entscheidungsstruktur gerechtfertigt sein. In einem weiteren Verfahren (C-203/22) wurde sogar die Offenlegung der konkreten Rechenlogik gefordert. Allgemeine Hinweise auf „statistische Verfahren“ oder „branchenübliche Bewertungskriterien“ reichen nicht mehr aus.
Diese juristische Entwicklung stellt die gesamte Geschäftsgrundlage von Auskunfteien infrage. Was bisher als „Betriebsgeheimnis“ galt, wird nun zum Prüfstein rechtlicher Zulässigkeit. Unternehmen wie die SCHUFA geraten dadurch zunehmend unter Druck – nicht nur durch die Gerichte, sondern auch durch die Öffentlichkeit. Eine aktuelle Umfrage des Max-Planck-Instituts belegt: Mehr als 70 Prozent der Verbraucher fühlen sich durch algorithmische Bewertungen benachteiligt oder missverstanden. Die Forderung nach Transparenz ist daher nicht nur juristisch, sondern auch gesellschaftlich begründet.
Löschpflicht statt Datengier: Neue Urteile setzen Grenzen
Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Speicherdauer negativer Einträge. In der Vergangenheit hatte sich die SCHUFA regelmäßig auf eine pauschale Dreijahresfrist berufen. Unabhängig davon, ob Forderungen bereits beglichen wurden. Doch auch diese Praxis gerät zunehmend ins Wanken. Das Oberlandesgericht Köln urteilte im April 2025, dass bezahlte Forderungen umgehend zu löschen seien, wenn kein sachlicher Grund für eine weitere Speicherung besteht. Die pauschale Beibehaltung solcher Einträge stelle einen Verstoß gegen Artikel 5 DSGVO dar, der die Datenminimierung und Speicherbegrenzung vorschreibt.
Das Landgericht Aachen ging in einem ähnlichen Fall sogar noch weiter: Ein veralteter SCHUFA-Eintrag hatte dort zu einer Kreditverweigerung geführt, obwohl der zugrunde liegende Sachverhalt längst abgeschlossen war. Die Richter entschieden im Sinne des Verbrauchers. mit Verweis auf Artikel 17 DSGVO, das sogenannte „Recht auf Vergessenwerden“. Auch eine Studie der Universität Bielefeld zeigt: Veraltete Einträge können massive Auswirkungen auf Lebensentscheidungen wie Wohnungssuche, Kreditvergabe oder Jobchancen haben. 82 Prozent der Befragten gaben an, sich durch solche Einträge in ihrer persönlichen Entwicklung behindert zu fühlen.
Die juristische Aufarbeitung solcher Fälle wird immer häufiger durch spezialisierte Kanzleien begleitet. Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte, Vertrauensanwalt der Plattform ABOWI Law, warnt: „Viele Verbraucher wissen gar nicht, dass sie ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung ihrer Daten haben – und dass sie dafür nicht einmal einen Anwalt brauchen. Aber wer sich nicht wehrt, bleibt Opfer eines Systems, das sich selbst schützt.“
Seine Kanzlei unterstützt Betroffene bei der Geltendmachung von Auskunftsrechten und der Durchsetzung von Schadensersatzforderungen. Schulte beobachtet einen deutlichen Anstieg an Mandanten, die sich gezielt gegen falsche oder veraltete SCHUFA-Einträge zur Wehr setzen. Auch die Zusammenarbeit mit Plattformen wie ABOWI UAB gewinnt an Bedeutung. Diese bieten ergänzend zum juristischen Weg ein digitales Reputationsmanagement an, das die Sichtbarkeit negativer Einträge im Netz minimieren kann – ein entscheidender Vorteil für Selbstständige, Unternehmer und Menschen mit öffentlicher Wirkung.
Der digitale Score als Machtinstrument – und was man dagegen tun kann
Die Debatte rund um den SCHUFA-Score wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie viel Macht dürfen Algorithmen über unser Leben haben? Wie transparent muss eine Bewertung sein, die darüber entscheidet, ob jemand einen Kredit, eine Wohnung oder sogar einen Arbeitsvertrag erhält? Die Antworten darauf zeichnen sich langsam, aber eindeutig ab. Der Gesetzgeber hat mit der DSGVO einen Rahmen geschaffen, der die Rechte der Verbraucher stärkt. Die Gerichte nutzen diesen Rahmen zunehmend konsequent. Und Experten bewerten die aktuelle Rechtsprechung als „historischen Wendepunkt im Kampf gegen algorithmische Intransparenz.“
Für Verbraucher ergeben sich daraus konkrete Handlungsmöglichkeiten. Wer seine gespeicherten Daten prüfen möchte, kann dies durch einfache Auskunftsersuchen bei Auskunfteien tun. Musterbriefe und Onlineformulare stehen auf zahlreichen Verbraucherportalen bereit. Wird keine oder nur unzureichende Auskunft erteilt, kann dies rechtlich verfolgt werden – in vielen Fällen sogar mit Anspruch auf Entschädigung. Betroffene sollten nicht zögern, ihre Rechte geltend zu machen, denn die Beweislast liegt meist bei den Auskunfteien.
Auch politische Initiativen gewinnen an Fahrt. In Brüssel wird derzeit an einer „Verordnung zur Fairness von Scoring-Verfahren“ gearbeitet, die europaweit einheitliche Mindeststandards schaffen soll. Ziel ist es, algorithmische Bewertungen nachvollziehbarer, kontrollierbarer und rechtskonformer zu gestalten – ganz im Sinne der DSGVO.
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte betont abschließend: „Der Algorithmus darf nicht zum Richter über das Leben der Menschen werden. Wer bewertet, muss erklären können, wie und warum. Nur so entsteht das, was unsere Gesellschaft dringend braucht: Vertrauen in die digitale Ordnung.“
Fazit: Wer bewertet, muss erklären – oder verliert die Legitimation?
Die aktuelle Rechtsprechung macht deutlich: Der algorithmische Score darf kein geheimnisvoller Schattenrichter über unsere Lebensrealität bleiben. Wenn Bonitätsbewertungen Existenzen beeinflussen, Kredite blockieren oder Lebensentwürfe gefährden, stellt sich eine zentrale juristische Frage: Wie lange darf ein System entscheiden, ohne sich erklären zu müssen?
Die Gerichte beginnen, diese Frage mit wachsender Klarheit zu beantworten, zugunsten der Verbraucher. Die DSGVO ist dabei kein zahnloser Tiger, sondern ein Instrument echter Transparenz. Wer seine Rechte kennt und nutzt, kann sich mit wachsender Erfolgsaussicht wehren.
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte bringt es pointiert auf den Punkt: „In Zeiten der algorithmischen Bewertung ist der mündige Verbraucher kein Mythos, sondern eine Notwendigkeit. Wer sich nicht sichtbar macht, wird automatisch aussortiert – und das darf nicht sein. Das Recht auf Erklärung ist kein Luxus, sondern demokratischer Mindeststandard im digitalen Zeitalter.“
Die Zukunft gehört jenen, die Kontrolle fordern, nicht jenen, die im Stillen bewerten.