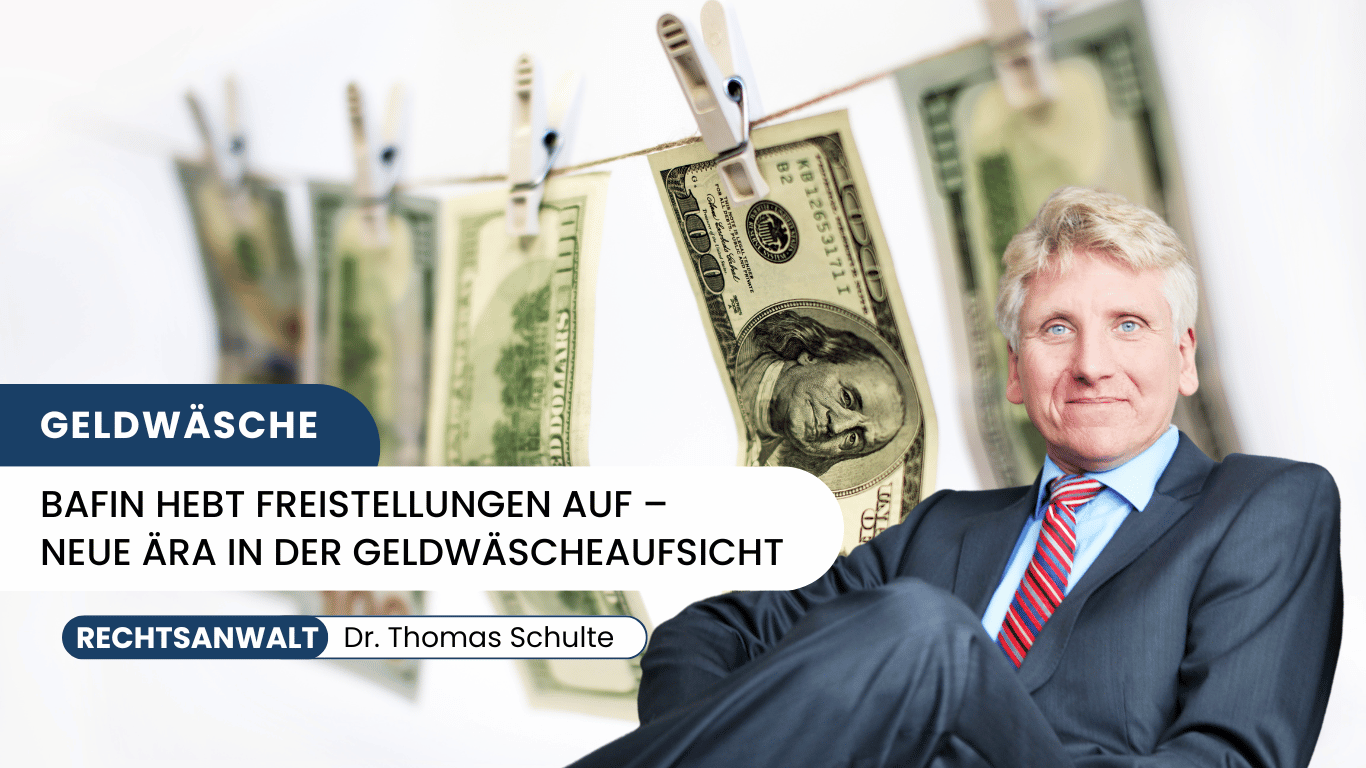Warum die Aufsicht jetzt den Druck erhöht, welche Branchen besonders betroffen sind – und welche juristischen Fragen sich aus der neuen EU-Geldwäscheverordnung ergeben.
Die Weichen für die europäische Geldwäscheaufsicht werden neu gestellt – und die BaFin macht unmissverständlich klar, dass die Übergangszeit vorbei ist. Mit einer aktuellen Allgemeinverfügung streicht sie zentrale Freistellungen im Geldwäschegesetz (GwG), die bislang einzelnen Unternehmen und Branchen Erleichterungen bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten gewährt hatten. Hintergrund ist die EU-Geldwäscheverordnung, die am 10. Juli 2027 in Kraft treten wird und als Meilenstein einer einheitlichen europäischen Aufsichtsarchitektur gilt.
Die Dimension dieser Umstellung ist enorm: Laut Schätzungen der Financial Intelligence Unit (FIU) wurden allein 2024 in Deutschland über 370.000 Verdachtsmeldungen wegen potenzieller Geldwäsche registriert – ein Anstieg von rund 46 Prozent gegenüber 2022. Besonders Finanzdienstleister, Immobilienmakler und der Handel mit hochwertigen Gütern stehen im Fokus, da sie als besonders anfällig für missbräuchliche Transaktionen gelten.
Juristisch drängt sich die Frage auf: Welche Pflichten treffen Unternehmen bereits heute, wenn die neuen EU-Vorgaben erst in zwei Jahren gelten? Und noch brisanter: Darf die BaFin nationale Erleichterungen vorzeitig kassieren, um die EU-Standards vorzubereiten – oder überschreitet sie damit ihre Kompetenzen? Die Antworten darauf werden über die Compliance-Kosten, die Marktstrategien und die rechtliche Angriffsfläche vieler Unternehmen entscheiden.
Aktives Handeln statt abwartender Haltung
„Die Zurücknahme von Freistellungen ist ein eindeutiges Signal: Die BaFin agiert vorausschauend, proaktiv und zeigt gleichzeitig, dass die Zeit nationaler Sonderwege im Bereich der Geldwäscheprävention ein Ende hat“, so Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt aus Berlin und Experte für Finanz- und Vertragsrecht. Die nationale Finanzaufsicht bereitet durch diesen Schritt sowohl sich selbst als auch die nach dem GwG verpflichteten Unternehmen auf die neuen Herausforderungen einer einheitlichen EU-Regulierung vor.
Die europäische Geldwäscheverordnung setzt ein deutliches Zeichen gegen die Fragmentierung auf nationaler Ebene und will die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf ein neues, gemeinsames Niveau heben. Der Berliner Jurist sieht darin einen Fortschritt: „Rechtsklarheit und einheitliche Maßstäbe innerhalb der Europäischen Union sind unerlässlich, wenn es um die Integrität des europäischen Finanzsystems geht.“
Das Ende nationaler Sonderregelungen

Im Zentrum der aktuellen Maßnahme steht die Rücknahme von nach dem GwG bisher zulässigen Freistellungen. Diese wurden in der Vergangenheit genutzt, um bestimmte Verpflichtete von einzelnen Anforderungen der Geldwäscheprävention zu befreien – beispielsweise kleinere Unternehmen oder spezifische Tätigkeitsbereiche. Mit der neuen europäischen Gesetzgebung wird diesen Spielräumen ein Riegel vorgeschoben.
Die Allgemeinverfügung der BaFin sorgt somit für eine Angleichung an das zukünftige Niveau der Geldwäscheprävention und verhindert mögliche Umgehungsstrategien. Nach Auffassung von Dr. Schulte eine begrüßenswerte Entwicklung: „Die Harmonisierung der Aufsichtsvorgaben stärkt nicht nur das Vertrauen in den Rechtsrahmen, sondern schützt auch einzelne Marktteilnehmer besser vor Rufschädigungen und Haftungsrisiken.“
Rechtliche Grundlagen der neuen Ordnung
Der rechtliche Rahmen ergibt sich aus der neuen EU-Geldwäscheverordnung, womit erstmalig eine unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten geltende Regelung zur Geldwäscheprävention geschaffen wird. Dies bedeutet, dass es keiner Umsetzung mehr durch nationale Parlamente bedarf – ein bedeutungsvoller Schritt, gerade aus der Perspektive eines auf Aufsichtsrecht spezialisierten Juristen.
Derzeit stützen sich Maßgaben der Geldwäscheaufsicht sowohl auf die EU-Richtlinie (etwa die 5. EU-Geldwäscherichtlinie) als auch auf das deutsche Geldwäschegesetz. Die neue Verordnung wird jedoch die vorrangige Norm darstellen. Paragraph 1 Abs. 1 GwG bestimmt: „Dieses Gesetz dient der Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung…“. Bald ersetzt durch die unmittelbar anwendbare Verordnung, wird dieser Paragraph seine zentrale Stellung in der nationalen Ausführung verlieren.
Zugleich wird der Spielraum der BaFin bei der Ausgestaltung einzelner Anforderungen reduziert – eine Entwicklung, die aus Sicht des Juristen Schulte sinnvoll ist: „Nur durch eine zentrale europäische Regelung können gleiche Wettbewerbsbedingungen und flächendeckende Rechtssicherheit entstehen.“
Einheitliche Aufsicht statt Flickenteppich
Dr. Thomas Schulte warnt jedoch auch vor den Herausforderungen, die mit dieser Umstellung auf Verpflichtete und Berater zukommen: „Der Wegfall der Freistellungen sorgt für mehr Aufwand und Bedarf einer intensiven Vorbereitung – insbesondere in Sachen technischer und personeller Ausgestaltung von Compliance-Strukturen.“ Alle Unternehmen müssen sich auf neue Pflichten einstellen – sowohl was Identitätsprüfungen, Meldestrukturen als auch interne Schulungen angeht.
Die Allgemeinverfügung der BaFin übernimmt somit auch eine pädagogische Funktion: Sie dient der Sensibilisierung und der Einleitung eines mentalen Umbruchs in der Compliance-Kultur vieler Marktteilnehmer. Gerade kleine und mittlere Unternehmen werden sich neu aufstellen müssen. Die bisher mögliche Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen wird nicht länger zur Verfügung stehen, wodurch der Rechtsrahmen klarer, aber auch strenger wird.
Mehr Verantwortung für Anbieter digitaler Dienste
Ein besonderes Augenmerk gilt den Plattformen und Anbietern digitaler Dienste – insbesondere solchen, die auf Blockchains oder ähnlichen Technologien basieren. Auch sie sind in vielen Fällen Verpflichtete im Sinne der Geldwäschevorschriften. Die neue Verordnung enthält explizite Passagen zu Virtual Asset Service Providers (VASPs) und erlegt diesen Anforderungen auf, die bislang in nationalen Gesetzen unterschiedlich geregelt waren.
Dr. Schulte sieht hierin eine logische Konsequenz aus der technischen Entwicklung: „Hier zeigt sich das proaktive Verständnis der EU-Gesetzgebung. Digitale Märkte benötigen einheitliche Kontrollmechanismen. Was offline gilt, muss zunehmend auch online seine Gültigkeit entfalten.“
Regelungen werden hochwertiger – Pflicht zur Qualität
Ein wesentlicher Bestandteil der Geldwäscheprävention ist die Erstellung und Umsetzung von Risikoanalysen. Die neue Verordnung wird erwarten, dass Verpflichtete fundiertere, dokumentierte Darstellungen ihrer individuellen Risikoexposition vorlegen. Für viele Unternehmen bedeutet dies eine Neuorganisation ihres internen Risikomanagements.
Dr. Schulte erläutert: „Das Ziel ist nicht Bürokratie, sondern Schutz vor schweren Straftaten. Je höher die Qualität der Risikoanalyse und -vorsorge, desto größer der Schutzschild gegen das Eindringen von kriminellen Finanzströmen.“ Statt mit möglichst geringem Aufwand gesetzliche Anforderungen „zu erfüllen“, setzt die neue Gesetzgebung auf inhaltliche Qualität. Auch hier eröffnet sich für spezialisierte Rechtsanwälte ein neues Tätigkeitsfeld: die Begleitung und Überprüfung von Risikoanalysen und Verfahrensbeschreibungen.
Technologieeinsatz und Digitalisierung als Schlüsselrolle
Zunehmend werden Technologie und automatisierte Verfahren in der Bekämpfung von Geldwäsche eine Rolle spielen. Machine Learning, künstliche Intelligenz und Blockchain-Analytik bilden die Grundlage moderner AML-Systeme (Anti-Money Laundering). Doch auch rechtlich werfen diese Entwicklungen Fragen auf: Wer haftet bei Fehlentscheidungen eines Algorithmus? Inwiefern ist eine KI-gestützte Kundenprüfung mit Datenschutzvorgaben vereinbar?
„Die juristische Begleitung technologischer Neuerungen gehört zu den dringendsten Aufgaben unserer Zeit“, betont Dr. Thomas Schulte. „Wenn Digitalisierung auf Regulierung trifft, prallen zwei Welten aufeinander. Es liegt an uns Juristen, eine Brücke zu bauen, damit Wirtschaft und Recht harmonisch zusammenwirken.“
Fazit: Die Zukunft ist europäisch
Die Allgemeinverfügung der BaFin bildet das Bindeglied zwischen alter nationaler Praxis und zukünftiger europäischer Einheitlichkeit. Sie ist damit keineswegs nur ein „Verwaltungsakt“, sondern ein symbolisches wie auch sehr konkretes Signal: Die Geldwäscheaufsicht wird gestärkt, vereinheitlicht und modernisiert.
Unternehmen, Berater und Juristen sind aufgefordert, diesen Prozess aktiv zu begleiten – nicht aus Angst vor Sanktionen, sondern aus Interesse an einem stabilen, transparenten Finanzsystem. Die Vorbereitung auf 2027 beginnt jetzt – mit rechtlicher Weitsicht, technologischer Offenheit und strategischer Planung.