Neue Zeiten für die Bankenaufsicht – zwischen Regulierung, Digitalisierung und Krisenfestigkeit. Wie viel Regulierung verträgt der Finanzmarkt, wenn gleichzeitig Innovation, Digitalisierung und geopolitische Unsicherheiten den Druck erhöhen? Und kann eine Behörde wie die BaFin im Zusammenspiel mit Politik, Banken und Verbrauchern überhaupt noch alle Interessen in Balance halten?
Die deutsche Bankenaufsicht befindet sich mitten in einem Transformationsprozess. Technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr, die wachsende Bedeutung von Krypto-Assets und gleichzeitig zunehmende wirtschaftliche Turbulenzen setzen die Institutionen unter Druck. In diesem Spannungsfeld blickt Nikolas Speer, der neue Exekutivdirektor der Bankenaufsicht bei der BaFin, auf seine ersten 100 Tage im Amt zurück – ein Zeitpunkt, der sowohl persönliche Weichenstellungen als auch die strategische Neuausrichtung der Behörde offenbart.
Für Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt aus Berlin, stellt sich dabei die entscheidende juristische Frage: Wie gelingt es, die Aufsicht so auszugestalten, dass sie Rechtssicherheit garantiert, Verbraucher schützt und gleichzeitig den Spielraum für Innovation nicht erstickt?
Die Rolle der Risikoaufsicht in einer dynamischen Finanzwelt
Die Kernaufgabe der BaFin besteht darin, die Stabilität des deutschen Finanzsystems zu gewährleisten. Dabei spielen Risiken in unterschiedlichster Form eine zentrale Rolle. Dies betrifft insbesondere das Kreditrisiko, das in deutschen Banken traditionell eine zentrale Rolle einnimmt. „Das Kerngeschäft von Banken ist es, Risiken einzugehen – aber auf kalkulierte Weise“, betont Speer im Interview. Rechtlich gesehen ergibt sich daraus eine bedeutsame Verbindung zum Kreditwesengesetz (KWG), genauer gesagt zu § 25a KWG, der verbindliche Anforderungen an das Risikomanagement von Instituten stellt. Hier die Vorschrift im Wortlaut:
„Ein Institut hat eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation zu gewährleisten, welche die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch das Institut gewährleistet. Dazu gehört insbesondere ein angemessenes und wirksames Risikomanagement.“
Die Umsetzung dieser gesetzlichen Anforderung liegt im Fokus der Bankenaufsicht. Für Juristen bedeutet dies die Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Beratung der Institute hinsichtlich organisatorischer Strukturen sowie der internen Kontrollsysteme.
Cyberrisiken und digitale Verwundbarkeit
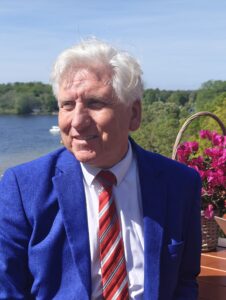
Ein Aspekt, der in den letzten Jahren rasch an Bedeutung gewonnen hat, sind sogenannte nichtfinanzielle Risiken, insbesondere Cyberrisiken. Die digitale Transformation hat die Geschäftsmodelle der Banken nicht nur effizienter, sondern auch anfälliger gemacht. Im Fachartikel mit Interview hat Speer verdeutlicht, dass Kapitalvorschriften allein nicht ausreichen, sondern die Banken dazu gebracht werden müssen, präventiv zu erkennen, wo Gefährdungen entstehen können.
Aus juristischer Sicht bedeutet dies eine zunehmende Verzahnung von IT-Recht, Datenschutzrecht und dem traditionellen Bankrecht. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit resultieren nicht nur aus regulativen Texten wie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), sondern auch aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem neuen Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0).
Es ist daher für Rechtsanwälte unerlässlich, interdisziplinäre Expertise aufzubauen, um Mandanten in diesen komplexen Feldern adäquat beraten zu können. Besonders in Haftungsfragen und in Bezug auf die Durchsetzbarkeit von Verträgen über IT-Dienstleistungen wird Fachwissen zunehmend gefordert.
Governance als Fundament des Vertrauens
Ein weiterer Pfeiler der effektiven Bankensteuerung ist eine gute Governance-Struktur. Speer bringt dies im Interview treffend auf den Punkt und erläutert, dass, wenn Institutionen in Schieflage geraten, die Ursache häufig in schlechtem Management oder mangelnder Aufsicht durch den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat liegt.
Auch hier hat der Gesetzgeber entsprechende Vorgaben gemacht. Nach § 25d KWG müssen insbesondere die Leitungs- und Aufsichtsorgane fachlich geeignet sowie persönlich zuverlässig sein. Für juristische Begleiter von Banken bedeutet dies eine intensive Begleitung bei Auswahlprozessen, bei der Gestaltung von Geschäftsordnungen sowie regelmäßig bei der rechtlichen Bewertung von Interessenskonflikten und Ermittlungen im Falle von Verdachtsmomenten.
Aus Erfahrung weiß der Jurist: Fehler in der Governance sind oftmals die Wurzel umfassender wirtschaftlicher und juristischer Probleme. Frühzeitige rechtliche Steuerung hilft, kostspielige Aufsichtsverfahren sowie Reputationsschäden zu vermeiden.
Simplicity und Proportionalität – die neue Aufsichtskultur
Besonders hervorzuheben sind Speers Betonung im Interview auf die Reduktion von Komplexität und die Berücksichtigung der Proportionalität. Hierzu führt Speer aus, dass gerade in Deutschland mit rund 1.300 Instituten kleinere Banken mit überschaubaren Risiken nicht denselben extrem strengen Anforderungen unterworfen werden dürfen wie Großbanken.
Diesen Gedanken greift die Aufsicht zunehmend in Form von differenzierten Regulierungen auf. Die angekündigte Überarbeitung der MaRisk ist ein Beispiel für die Abkehr von starren Vorgaben hin zu prinzipienbasierten Regelwerken. Das hat auch Auswirkungen auf die Rechtsberatung, denn pauschale Lösungen verlieren an Geltung – es geht vielmehr um die Bewertung und rechtssichere Umsetzung von individuellen Vorgaben.
Für die öffentliche Verwaltung stellt sich zudem die Frage nach der Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Artikel 3 Grundgesetz verlangt, dass der Gesetzgeber Ungleiches auch ungleich behandelt. Die Proportionalität ist hier nicht nur eine aufsichtsrechtliche Strategie, sondern auch ein verfassungsrechtliches Gebot.
Das persönliche Gespräch als Aufsichtsinstrument
Eine interessante Wendung nimmt das Interview, wenn Speer die Bedeutung persönlicher Kontakte betont. Zahlen, Berichte und Organigramme sind wichtig – aber sie erzählen nie die ganze Geschichte, lässt sich die Aussage zusammenfassen. Für Juristen, die Banken begleiten, ergibt sich daraus die Erkenntnis, dass Audits, Besprechungen und persönliche Bewertungen nicht nur Ergänzung, sondern zentraler Bestandteil einer effektiven Aufsicht sind.
Deshalb ist es für Banken besonders wichtig, dass auch ihre juristischen Berater mit der Sprache der Aufsicht umgehen können – sei es beim Gespräch mit der BaFin, bei der Kommunikation mit der Bundesbank oder im Kontakt mit europäischen Institutionen.
Daten und künstliche Intelligenz – neue Werkzeuge der Bankenaufsicht
Nicht zuletzt weist Speer auf den strategischen Umgang mit Daten und künstlicher Intelligenz hin. Der Begriff der „datenbasierten Aufsicht“ zeigt, wohin die Reise geht: weg von reaktiven, hin zu proaktiven Maßnahmen. Automatische Analysen, Mustererkennung und intelligente Frühwarnsysteme sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern werden gegenwärtig umgesetzt.
Für Rechtsanwälte wirft dies die Frage auf, wie Algorithmen rechtlich zu bewerten sind: Dürfen Entscheidungen automatisiert getroffen werden? Welche Haftungsregeln gelten bei Entscheidungen einer KI? Hier stehen wichtige juristische Debatten bevor, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem kürzlich verabschiedeten EU AI Act.
Fazit: Eine anspruchsvolle Aufsicht braucht rechtliche Begleitung – Aufsicht als Garant für Gerechtigkeit, Verbraucherschutz und Verantwortung
Eine anspruchsvolle Aufsicht braucht mehr als klare Regeln – sie braucht ein Bewusstsein für Gerechtigkeit, Verbraucherschutz und gesellschaftliche Verantwortung. Unter der Führung von Nikolas Speer setzt die BaFin ein starkes Signal: Aufsicht darf sich nicht allein in Kapitalquoten und Paragraphen erschöpfen, sondern muss den Wandel der digitalen Zeit aufgreifen und die Banken aktiv dazu anhalten, Risiken frühzeitig zu erkennen und präventiv zu handeln.
Für mich als Jurist bedeutet das: Die Zukunft des Finanzsektors ist untrennbar mit einer modernen, prinzipienbasierten Rechtsbegleitung verbunden. Wir Juristen müssen die Sprache der Technologie verstehen, die Verästelungen des Aufsichtsrechts überblicken und gleichzeitig die Stimme der Verbraucher im Blick behalten. Denn nur so entsteht ein System, das nicht nur rechtlich sauber funktioniert, sondern auch gesellschaftlich legitimiert ist.
Bankgeschäfte werden auch künftig riskant bleiben – sei es durch Cyberangriffe, volatile Märkte oder komplexe Produkte. Doch darin liegt gerade die Verantwortung der Aufsicht: nicht Risiken auszuschalten, sondern Rahmen zu schaffen, die Fairness und Vertrauen garantieren. Ein Finanzmarkt ohne Vertrauen ist nichts anderes als ein Kartenhaus – ein Markt mit klarer Aufsicht und rechtlicher Begleitung hingegen kann Stabilität, Innovation und Sicherheit zugleich bieten.
Der Blick nach vorn zeigt: Wer sich heute rechtlich klug aufstellt, wer Compliance nicht als Pflicht, sondern als Chance begreift, der gewinnt nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit. Aufsicht, Politik, Banken und Juristen müssen deshalb enger zusammenwirken, um das zu erreichen, was Verbraucher erwarten dürfen: ein gerechtes, transparentes und verantwortungsvolles Finanzsystem, das der Gesellschaft dient – und nicht umgekehrt.
Die BaFin richtet sich unter der Führung von Nikolas Speer neu aus – inhaltlich, strukturell und technologisch. Für mich als Jurist ist klar: Die zunehmende Technologisierung, der Wandel hin zu prinzipienbasierten Regelwerken und die Notwendigkeit individueller Aufsichtsmaßnahmen fordern eine moderne juristische Begleitung. Dazu gehört ein tiefes Verständnis des Finanzsystems ebenso wie die Fähigkeit, in vernetzten Rechtsgebieten zu agieren.
Auch in Zukunft wird Banking ein Geschäft mit Risiken bleiben – und damit ein Geschäftsfeld für Aufsicht, Compliance und juristische Verantwortung. Wer sich frühzeitig rechtlich aufstellt, gewinnt Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.








