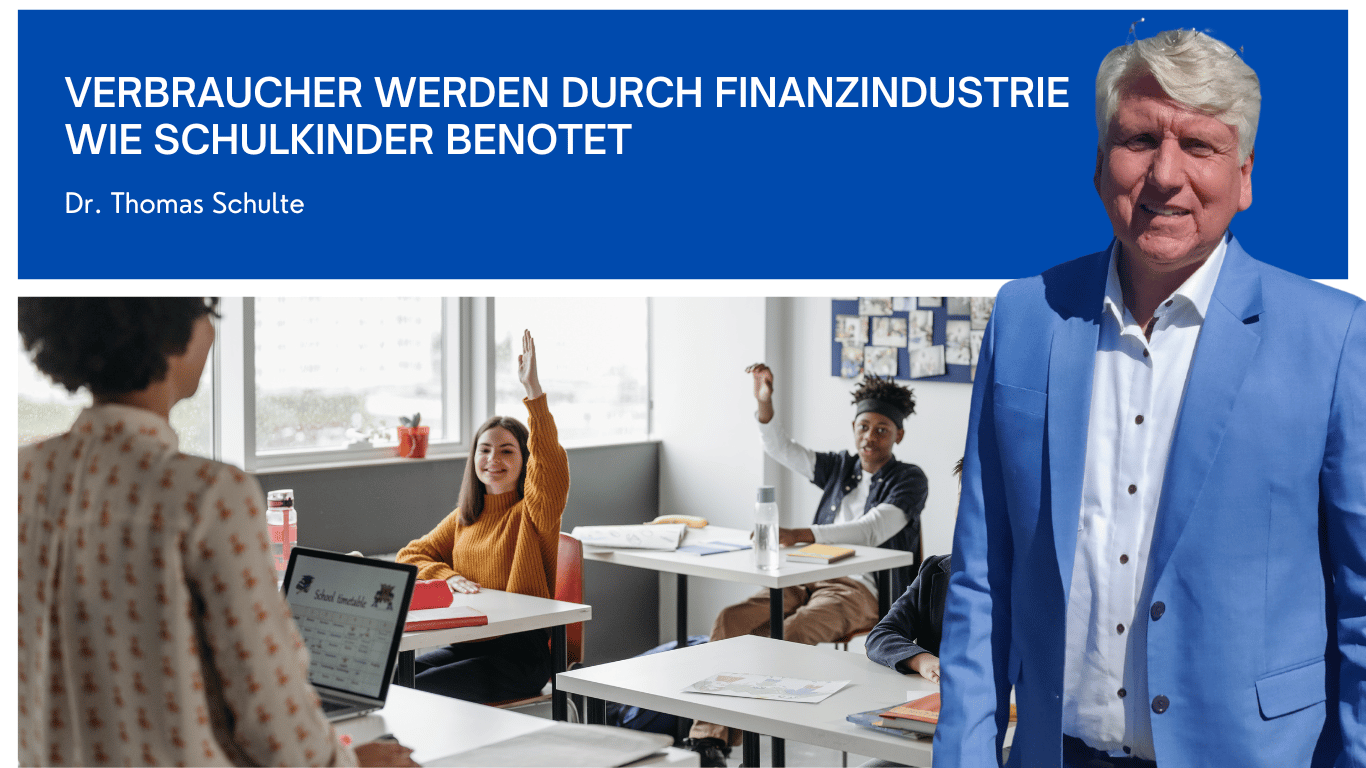Deutsche Auskunfteien wie Schufa und Co sammeln unterschiedlichste Daten von Verbrauchern: Anschriftendaten, Daten aus sozialen Netzwerken, Daten aus Internetforen, Angaben zur Staatsangehörigkeit, zum Geschlecht. Ein Artikel von 2015 mit einem Update von 2025 von Dr. Thomas Schulte, RA
Diese Daten werden durch verschiedene Auswertungsverfahren berechnet, zusammengestellt und sollen Auskunft auf die Bonität und Kreditwürdigkeit des Betroffenen geben. Dazu zählt das Scoring-Verfahren, dieses wird u. a. zur Berechnung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern und Unternehmern verwendet. Dr. Schulte, Fachanwalt, hierzu: „Im Grunde werden Verbraucher wie Schulkinder benotet. Sind die Verbraucher schlechte oder gute Zahler, darum geht es!“
Scoring ist gleich Wahrscheinlichkeitsberechnung – Verbraucherverhalten
Der Begriff „Scoring“ ist nicht gesetzlich definiert. Das „Scoring“ ist aber gesetzlich erlaubt. Eine Regelung findet sich z. B. in § 28b Bundesdatenschutzgesetz (kurz BDSG). Der Begriff „Score“ stammt aus der englischen Sprache und bedeutet sinngemäß ins Deutsche übersetzt „Punktestand“. Der englische Begriff „Scoring“ bezeichnet eine Punktebewertung oder ein Punktwertfahren. Rechtsanwalt Dr. Schulte: „Hat ein Verbraucher eine 4 minus oder eine fünf, dann wird er nicht versetzt wie ein Schüler bzw. erhält keinen Kredit.“
Der Gesetzgeber hat die Regelung des § 28b BDSG mit dem Wort „Scoring“ überschrieben. In der Regelung selbst finden sich dann Zwecke und Anforderungen für die Zulässigkeit der Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte für ein bestimmtes Verhalten des Betroffenen.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in seiner Entscheidung vom 28.01.2014 zum Az. VI ZR 156/13 mit der Vorschrift des § 28 BDSG auseinanderzusetzen. Dabei führt der BGH zum Begriff „Score“ aus: „Ein Score stellt einen Wahrscheinlichkeitswert über das künftige Verhalten von Personengruppen dar, der auf Grundlage statistisch-mathematischer Analyseverfahren berechnet wird“. Sieht man in der Begründung des BGH nunmehr den Versuch, den Begriff bzw. die Überschrift „Scoring“ zu definieren, so müsste das Scoring-Verfahren weitaus genauer gesetzlich geregelt werden, als dies bisher die Regelung des § 28b BDSG vorsieht.
Die Macht von Datensammlungen? Verbesserter Verbraucherschutz durch Datentransparenz?
Auch innerhalb der Politik gibt es Stimmen, die das sog. Scoring-Verfahren verbraucherfreundlicher gestalten wollen. Am 12.05.2015 wurde bekannt, dass die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen einen Gesetzesentwurf zur „Verbesserung der Transparenz und der Bedingung beim Scoring“ im Bundestag eingebracht hat. Ausschlaggebend für den Gesetzesentwurf war u. a. eine Studie des Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein und der GP-Forschungsgruppe, welche im Jahr 2014 abgeschlossen wurde. Aber auch die Entscheidung des BGH aus Januar 2014 ist Anlass für den eingebrachten Gesetzesentwurf. Hier hatte der Bundesgerichtshof letztendlich entschieden, dass die Score-Formel nicht preisgegeben werden muss. Sie ist ein Geschäftsgeheimnis und braucht dem Betroffenen nicht offenbart werden.
Kern des Gesetzesentwurfs ist die Schaffung von mehr Transparenz beim Scoring-Verfahren
Derzeit unterliegt die Art der zu speichernden und für das Scoring verwendbaren Daten kaum einer Eingrenzung. Dies beabsichtigt die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen durch den eingebrachten Gesetzesentwurf zu konkretisieren.
Nach Meinung der Fraktion soll hier durch den Gesetzgeber klar geregelt werden, welche Daten bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte nicht berücksichtigt werden dürfen. In dem Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes – Verbesserung der Transparenz und der Bedingungen beim Scoring (Scoringänderungsgesetz) findet sich folgender Änderungsvorschlag:
„§ 28b wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und dieser wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 4 lautet wie folgt gefasst:
4. Für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts zum Zwecke der Bonität keine Anschriftendaten, Daten aus sozialen Netzwerken, Daten aus Internetforen, Angaben zur
Staatsangehörigkeit, zum Geschlecht, zu einer Behinderung oder Daten nach § 3 Absatz 9 genutzt werden“,
weiterhin wurde folgender Änderungsvorschlag ebenfalls eingebracht:
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Das wissenschaftlich anerkannte mathematisch-statistische Verfahren muss dem Stand der Wissenschaft und Forschung entsprechen. Das Nähere zu den Anforderungen an das wissenschaftlich anerkannte mathematisch-statistische Verfahren bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats.“
Auswirkungen und Konsequenzen für Auskunfteien, Unternehmen und Betroffenen?
Der Gesetzesentwurf enthält weitere Änderungsvorschläge. Die vorgeschlagenen Änderungen in ihrer Gesamtheit hätten weitreichende Konsequenzen für die Auskunfteien und das Scoring-Verfahren. Die bisherigen Verfahren könnten nicht mehr zur Anwendung kommen und die eigenen Bewertungen durch die Auskunfteien müssten weitreichende Änderungen erfahren. Auch für die Wirtschaft wären diese Änderungen von erheblicher Bedeutung. So müssten auch Banken ihren „Algorithmus“ ändern, vor allem in Bezug auf die Erstprüfung der Kreditwürdigkeit und Bonität anfragender Kunden.
Rechtsanwältin Danuta Wiest, Expertin für Schufa-Recht der Kanzlei Dr. Schulte gibt zu bedenken, dass für die Betroffenen selbst diese Änderungen endlich mit einer Transparenz und mehr Flexibilität im Wirtschaftsleben, Alltag und unabhängig vom Alter verbunden wären. „Damit würde den betroffenen Verbrauchern die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Bonität besser einschätzen und bewerten zu können.
Vor dem Hintergrund der derzeit in Ausarbeitung und Vorbereitung befindlichen europäischen Datenschutzverordnung 2015 bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit die Änderungsvorschläge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen von Erfolg gekrönt sein werden“, so Rechtsanwältin Wiest.
Feststeht aber bereits an dieser Stelle
Finden die Änderungsvorschläge keinen Eingang in die europäische Datenschutzverordnung, sondern lediglich im Bundesdatenschutzgesetz, haben Betroffene von dieser Änderung nur solange etwas, bis die europäische Datenschutzverordnung in Kraft getreten ist. Diese ist dann nämlich unmittelbar geltendes Recht und steht über dem Bundesdatenschutzgesetz.
Wie ist die Rechtslage zum Scoring 2025?
Die Rechtslage zum SCHUFA-Scoring im Jahre 2025 ist immer noch komplex und durch aktuelle Rechtsprechung sowie geplante Gesetzesänderungen in Bewegung.
Was ist Scoring und dessen Zweck?
Scoring ist ein mathematisch-statistisches Verfahren, das von Auskunfteien wie der SCHUFA verwendet wird, um Wahrscheinlichkeitswerte über das zukünftige Verhalten von Personen, insbesondere deren Zahlungsfähigkeit, zu erstellen. Ziel ist es, Kreditgebern, Vermietern oder anderen Vertragspartnern eine objektive Entscheidungsgrundlage zu liefern. Der SCHUFA-Score ist ein Wert zwischen Null und Hundert (oder 0 und 1.000), der die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls prognostiziert. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine schlechtere finanzielle Prognose bzw. Kreditwürdigkeit. Für verschiedene Branchen werden spezifische Scores ermittelt.
Rechtliche Grundlagen und Transparenz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die SCHUFA unterliegt der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Das Scoring-Verfahren ist in § 31 (vormals § 28b) BDSG geregelt, der die Nutzung gespeicherter Daten für Prognosen mittels eines wissenschaftlich anerkannten Verfahrens erlaubt. Die Verarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zulässig, wenn sie zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und die Grundrechte der Betroffenen nicht überwiegen.
Ein zentraler Kritikpunkt ist die fehlende Transparenz der genauen Berechnungsmethode (Score-Formel), die von der SCHUFA als Geschäftsgeheimnis behandelt wird. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied 2014, dass die SCHUFA zwar die verwendeten Datengattungen und das Ergebnis, nicht aber den genauen Rechenweg offenlegen muss.
Aktuelle Rechtsprechung und deren Auswirkungen
EuGH-Urteil vom 7. Dezember 2023 (C-634/21): Dieses Urteil stellt klar, dass das automatisierte SCHUFA-Scoring eine „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“ im Sinne von Art. 22 DSGVO darstellen kann, wenn Banken oder andere Dritte diesen Score als maßgebliche Grundlage für ihre Entscheidungen verwenden. Solche automatisierten Entscheidungen sind grundsätzlich nur unter strengen, durch Unionsrecht zugelassenen Bedingungen zulässig. Der EuGH äußerte „erhebliche Zweifel“ an der Vereinbarkeit der früheren deutschen Regelung (§ 31 BDSG a.F.) mit der DSGVO. Deutsche Gerichte müssen nun prüfen, ob die nationalen Gesetze eine gültige Ausnahme enthalten.
EuGH-Urteil vom 7. Dezember 2023 (C-26/22): Bezüglich der Speicherung von Daten aus dem Insolvenzregister (Restschuldbefreiung) stellte der EuGH fest, dass eine Speicherung durch Wirtschaftsauskunfteien nach der Löschung im öffentlichen Register das Ziel, dem Betroffenen eine erneute Teilnahme am Wirtschaftsleben zu ermöglichen, gefährdet. Diese Argumentation wird von Gerichten auf Einträge im Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO) übertragen.
Löschfristen und die „100-Tage-Regelung“ (Stand 2025): Während negative Einträge in der Regel nach drei Jahren nach Erledigung automatisch gelöscht werden (§ 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG), werden Einträge zur Restschuldbefreiung seit 28. März 2023 bereits nach 6 Monaten gelöscht. Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine neue Regelung, wonach die Speicherung von Daten über ausgeglichene Forderungen unter bestimmten Voraussetzungen bereits nach 18 Monaten endet, nicht mehr nach drei Jahren. Gerichte tendieren dazu, die Speicherfristen für erledigte Forderungen an die Fristen öffentlicher Register anzugleichen, was in einigen Fällen eine Löschung nach 6 Monaten nach Erledigung bedeuten kann.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Rechte der Verbraucher
Verbraucher haben umfassende Rechte im Umgang mit der SCHUFA, insbesondere durch die DSGVO. Dazu gehören:
- Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO, § 34 BDSG): Das Recht, einmal jährlich eine kostenlose Datenkopie über alle gespeicherten Daten anzufordern, inklusive Herkunft und Empfänger.
- Recht auf Information über Scoring (Art. 15 Abs. 1 h DSGVO): Bei einer Entscheidung, die maßgeblich auf dem Score basiert, haben Betroffene Anspruch auf Information über die automatisierte Entscheidungsfindung und eine verständliche Erläuterung der Score-Berechnung.
- Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 16, 17 DSGVO): Wenn Daten, die in die Score-Berechnung einfließen, falsch oder unrichtig sind, besteht ein Anspruch auf Berichtigung. Fehlerhafte oder unrechtmäßige Einträge müssen gelöscht werden. Allerdings besteht laut LG Wiesbaden kein Anspruch auf Löschung rechtmäßig erhobener Daten allein aufgrund von Art. 17 Abs. 1 lit. a DSGVO, wenn die Auskunftei ein legitimes Interesse an der Speicherung hat (z.B. wegen erhöhtem Ausfallrisiko). Bei strittigen Einträgen muss die SCHUFA den Eintrag während der Klärung sperren und darf ihn nicht weitergeben.
- Schadensersatz (Art. 82 DSGVO): Bei unrechtmäßigen SCHUFA-Einträgen kann ein Anspruch auf immateriellen Schadensersatz (z.B. wegen Rufschädigung) bestehen. Dieser richtet sich oft gegen das meldende Unternehmen, kann in Ausnahmefällen aber auch gegen die SCHUFA gehen. Gerichte haben Schadensersatzbeträge zugesprochen (z.B. 500 € oder 5.000 €). Der Schadenersatz hat eine Ausgleichsfunktion, keine Straf- oder Abschreckungsfunktion.
- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO): Es besteht ein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung, insbesondere wenn kein überwiegendes berechtigtes Interesse vorliegt.
Was tun bei einem negativen Eintrag?
- SCHUFA-Auskunft einholen: Überprüfen Sie Ihre gespeicherten Daten und identifizieren Sie den negativen Eintrag sowie das meldende Unternehmen.
- Rechtmäßigkeit prüfen: Überprüfen Sie, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Eintrag erfüllt waren, insbesondere ob die Forderung fällig, unbestritten und ordnungsgemäß gemahnt wurde. Die Beweislast liegt beim meldenden Unternehmen. Achten Sie auf Formfehler der meldenden Stelle.
- Reklamieren: Wenn Sie einen fehlerhaften oder unrechtmäßigen Eintrag feststellen, sollten Sie unverzüglich handeln.
- Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen: Fordern Sie die Löschung des unrechtmäßigen Eintrags direkt beim meldenden Unternehmen und der SCHUFA. Bei Uneinigkeit muss der Eintrag gesperrt werden.
- Anwaltliche Hilfe suchen: Es kann ratsam sein, einen spezialisierten Anwalt zu konsultieren, insbesondere bei unberechtigten Einträgen. Anwälte können die Rechtmäßigkeit prüfen und Ihre Ansprüche durchsetzen.
- Weitere Schritte: Außergerichtliche Klärung über die Ombudsfrau der SCHUFA oder eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde sind möglich. Scheitern diese, kann ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden.
- Schadensersatz prüfen: Bei nachweislich unrechtmäßigen Einträgen kann ein Anspruch auf Schadensersatz geprüft werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das SCHUFA-Scoring weiterhin ein wichtiges, aber auch umstrittenes Instrument ist. Die jüngste Rechtsprechung, insbesondere des EuGH, stärkt die Rechte der Verbraucher auf Transparenz und gegen rein automatisierte Entscheidungen, während geplante Gesetzesänderungen (BDSG 2025) kürzere Speicherfristen und weitere Einschränkungen für das Scoring vorsehen. Verbraucher sollten ihre Rechte aktiv nutzen, ihre Daten überprüfen und bei Bedarf rechtliche Schritte einleiten.
Mehr Informationen finden sich hier.
🔍 SCHUFA-Scoring & Datenschutzrecht
- „Schufa-Scoring unter Beschuss: Wie der EuGH die Rechte der Verbraucher gegen automatisierte Entscheidungen stärkt“
Analyse des EuGH-Urteils zur Zulässigkeit automatisierter Bonitätsbewertungen und deren Auswirkungen auf Verbraucherrechte. (schufa Archiv – Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt) - „Schufa-Scoring auf 100? Geheimnisse, Herausforderungen und der Überblick“
Erläuterung der Funktionsweise des SCHUFA-Scores, seiner Bedeutung für Kreditentscheidungen und der zugrunde liegenden Datenverarbeitung. (Schufa-Scoring auf 100? Geheimnisse, Herausforderungen und der …)
🗑️ Löschfristen & Speicherpraxis
- „Löschfristen-Chaos bei der SCHUFA“
Diskussion über die unklare gesetzliche Regelung von Löschfristen bei der SCHUFA und die Problematik der fortdauernden Speicherung erledigter Schulden. (Löschfristen-Chaos bei der SCHUFA – Dr. Thomas Schulte)
⚖️ Inkasso & rechtliche Rahmenbedingungen
- „Inkassounternehmen – endlich gesetzlich Klarheit durchgesetzt“
Überblick über die gesetzlichen Regelungen für Inkassounternehmen und deren Bedeutung für Verbraucher. (Inkassounternehmen – endlich gesetzlich Klarheit durchgesetzt)
🧾 Umgang mit SCHUFA-Einträgen
- „Schufa Einträge löschen – Wünsche aller Art von Seiten der Betroffenen“
Informationen über die Möglichkeiten und Grenzen bei der Löschung von SCHUFA-Einträgen und die rechtlichen Voraussetzungen dafür. (Löschfristen-Chaos bei der SCHUFA – Dr. Thomas Schulte)