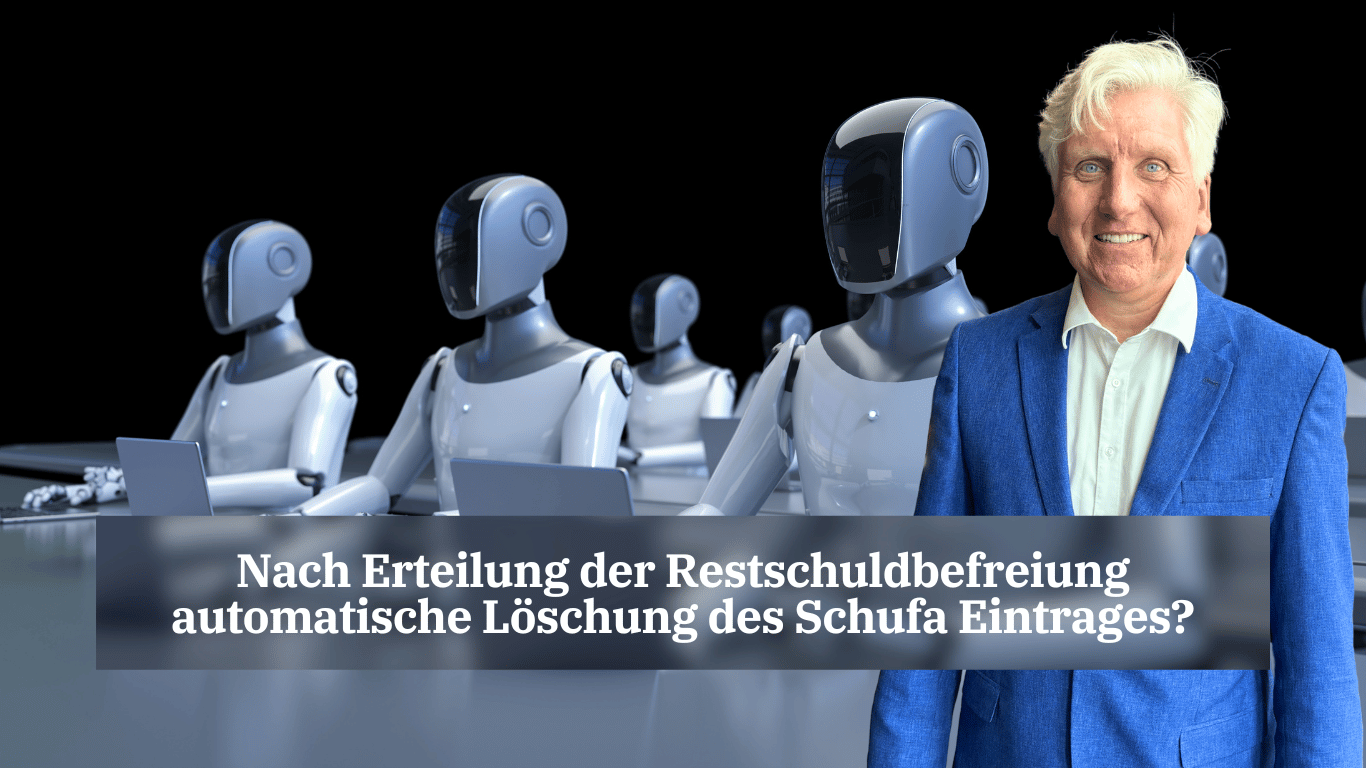Die Erteilung der Restschuldbefreiung wird im Datenbestand des Betroffenen bei der SCHUFA Holding AG gespeichert – Endlich die Restschuldbefreiung erteilt, jetzt kann es weitergehen – Sieht das die Wirtschaft auch so?
Zahlreiche Menschen in der Bundesrepublik Deutschland sind entweder aufgrund eigenen Verschuldens oder weil sie dritten Personen vertraut haben und damit eigentlich unverschuldet, in finanzielle Bedrängnis geraten. Ein Ausweg aus dieser Situation ist der Weg in die Insolvenz.
Während des Insolvenzverfahrens sind die Insolvenzschuldner in aller Regel redlich bemüht, ihre Gläubiger zu befriedigen. Hierzu wird den Insolvenzschuldnern ein Treuhänder zur Seite gestellt. Dieser erhält den pfändbaren Teil des monatlichen Gehalts, um die Gläubiger befriedigen zu können.
Nach einer entbehrungsreichen Zeit steht am Ende des Insolvenzverfahrens die Erteilung der Restschuldbefreiung.
Der Insolvenzschuldner hat es geschafft und kann nun wieder voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Ist das wirklich so? Die Zukunft voller Zuversicht sieht nach den Erfahrungen der Rechtsanwälte Dr. Schulte und sein Team leider nicht so aus.
Eintragung der Restschuldbefreiung im Datenbestand des Betroffenen bei der SCHUFA Holding AG
Die Erteilung der Restschuldbefreiung muss nach den gesetzlichen Vorgaben des § 9 Abs. 1 Insolvenzordnung (InsO) in Verbindung mit § 2 der Verordnung über öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren (InsBekV) veröffentlicht werden. Hierfür wurde das Portal www.insolvenzbekanntmachungen.de geschaffen.
Die Insolvenzbekanntmachungsverordnung enthält aber eine zeitliche Einschränkung. So ist die Veröffentlichung über die Erteilung der Restschuldbefreiung auf dem Portal www.insolvenzbekanntmachungen.de nach sechs Monaten – gerechnet ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung – zu löschen.
Des Weiteren ist eine uneingeschränkte Suche für jedermann nur für die Dauer von zwei Wochen ab dem Tag der Veröffentlichung möglich. Nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist müssen weitere Angaben, wie z.B. der Wohnort des Insolvenzschuldners, das Insolvenzgericht oder auch das Aktenzeichen des Insolvenzverfahrens angegeben werden, um ein Suchergebnis erzielen zu können.
Die zeitlichen Einschränkungen in der Insolvenzbekanntmachungsverordnung eröffnen durchaus die Diskussion, ob es sich bei dem Portal www.insolvenzbekanntmachungen.de um eine allgemein zugängliche Quelle handelt.
Stellt das Portal www.insolvenzbekanntmachungen.de eine allgemein öffentliche Quelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes dar? Drei Jahre Speicherfrist in Ordnung?
Bisher gehen die deutschen Zivilgerichte davon aus, dass es sich bei dem Portal www.insolvenzbekanntmachungen.de um eine allgemein zugängliche Quelle handelt. GottseiDank hat sich das geändert.
Nach der Auffassung der Rechtsanwälte Dr. Schulte und sein Team kann diese Auffassung jedoch nicht so einfach Bestand haben. Warum?
Das Portal www.insolvenzbekanntmachungen.de ist nicht so ohne weiteres eine allgemein zugängliche Quelle. Eine uneingeschränkte Suche ist immer nur für die Dauer von zwei Wochen gerechnet ab dem Tag der Veröffentlichung möglich. Dies spricht dafür, dass für die Dauer von zwei Wochen ab dem Tag der Veröffentlichung eine allgemein zugängliche Quelle vorliegt. Aber was ist nach Ablauf dieses Zeitfensters?
Um ein Suchergebnis erzielen zu können, sind weitere Angaben erforderlich. Kann hier wirklich davon ausgegangen werden, dass „jedermann“ über diese weiteren Angaben verfügt?
Wohl kaum, so die Auffassung der Rechtsanwälte Dr. Schulte und sein Team. Praktisch würde das nämlich bedeutet, dass jeder über jeden genauestens Bescheid weiß.
Wie lange muss der Betroffene mit dem Eintrag, dass ihm die Restschuldbefreiung erteilt wurde, in seinem Datenbestand leben?
Die Gerichte gehen davon aus, dass die SCHUFA Holding AG die Erteilung der Restschuldbefreiung für die Dauer von 3 Jahren speichern darf. Die Frist beginnt ab dem Kalenderjahr, welches dem Eintrag folgt. Ist die Restschuldbefreiung zum Beispiel im August 2008 erteilt und im Datenbestand eingetragen worden, beginnen die 3 Jahre am 01.01.2009 zu laufen. Die Prüfungsfrist endet dann am 31.12.2011.
Für die Betroffenen dauert damit das bereits beendete Insolvenzverfahren fort und ist auch nach 6 Jahren noch nicht beendet. Gerade Betroffene die am Anfang des Jahres die Restschuldbefreiung erhalten haben, müssen noch fast vier weitere Jahre mit diesem „Makel“ leben und sind wahrscheinlich nicht oder weiterhin nur beschränkt kreditwürdig.
Hier wird durch die Rechtsanwälte der Kanzlei Dr. Schulte und sein Team weiterhin die Auffassung vertreten, dass die Speicherpraxis der Auskunfteien angreifbar ist. Es geht hier um Fragen nach der Auslegung des Bundesdatenschutzgesetzes und auch um Fragen des Europarechts. Hierzu hatten sich Dr. Gärtner, Dr. Tintemann und Dr. Schulte bereits in einem wissenschaftlichen Beitrag in der Zeitschrift Verbraucher und Recht (VuR 2012, 54 ff.) geäußert.
In § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Bundesdatenschutzgesetz ist geregelt, wann gespeicherte Einträge zu prüfen sind. Danach besteht für nicht erledigte Sachverhalte eine Prüfungsfrist nach vier Jahren und für erledigte Sachverhalte eine Prüfungsfrist von drei Jahren. Die Frist wird berechnet ab dem Kalenderjahr, welches der erstmaligen Speicherung folgt.
Bei Einträgen durch Banken lässt sich der Tag der ersten Eintragung meist ohne weiteres nachvollziehen. Jedoch gilt dies nicht unbedingt auch für Mitteilungen aus öffentlichen Verzeichnissen, welche ebenfalls gespeichert werden.
Im Datenbestand des Betroffenen wird vermerkt, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Diese Angabe ist unter „Mitteilungen aus öffentlichen Verzeichnissen“ gespeichert. Hier wird seitens der Rechtsanwälte Dr. Schulte und sein Team die Auffassung vertreten, dass dies gemäß dem Wortlaut des § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Bundesdatenschutzgesetz die erstmalige Speicherung darstellt. Ab dem dieser Speicherung folgenden Kalenderjahr würden damit die nach dem Bundesdatenschutzgesetz maßgeblichen Prüfungsfristen zu laufen beginnen.
Die erste Prüfungsfrist endet dabei nach 4 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen. Somit würde erneut eine weitere Prüfungsfrist von vier Jahren zu laufen beginnen. In diesem zweiten Prüfungszeitraum wird in aller Regel die Restschuldbefreiung erteilt und somit gesehen das Insolvenzverfahren erledigt. Nach dem Wortlaut des Gesetzes verkürzt sich damit die Prüfungsfrist auf nur noch drei Jahre.
Mit der Speicherung des Merkmals „Erteilung der Restschuldbefreiung“ werden in der Regel die vorhergehenden Einträge, die das Insolvenzverfahren betreffen, gelöscht und durch den Eintrag „Restschuldbefreiung erteilt“ ersetzt. Der Betroffene kann die erstmalige Speicherung anlässlich seines Insolvenzverfahrens dann meist nicht mehr als seiner eigenen Selbstauskunft erkennen.
Gibt es Möglichkeiten dagegen vorzugehen?
Ja, die Frist wurde jetzt durch ein bahnbrechendes Urteil abgekürzt auf 6 Monate. – Oberlandesgericht Schleswig, Urteil vom 02.07.2021 – Az.: 17 U 15/21 – hier wurde die Löschungsfrist auf sechs Monate verkürzt. Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen. Hintergrund war, dass inzwischen des Bundesdatenschutzgesetz durch die Datenschutzgrundverordnung abgelöst wurde. Das Jahr 2025 markiert eine Zeitenwende im Umgang mit personenbezogenen Daten bei der Bonitätsprüfung. Neue gesetzliche Regelungen, richtungsweisende Urteile und eine kritische öffentliche Debatte zeigen: Die Kontrolle über die eigene Bonität ist kein unerreichbares Ziel mehr – sondern ein einklagbares Recht. Wer die neuen Regeln kennt, kann sich erfolgreich gegen unrechtmäßige SCHUFA-Einträge wehren.
Was gilt 2025? Wie ist die Rechtslage?
Das Jahr 2025 im Fokus der Rechtsentwicklung
Das Jahr 2025 scheint ein Jahr bedeutender Entwicklungen im Bereich des Datenschutzrechts und der Bonitätsprüfung in Deutschland zu sein, geprägt durch neue gesetzliche Vorhaben und richtungsweisende Gerichtsentscheidungen. Es wird sogar als „Jahr der Wende“ bezeichnet.
Reformen durch das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 2025)
Eine Quelle spricht von einem neuen Bundesdatenschutzgesetz 2025, das mehr Fairness in die Bonitätsprüfung bringen soll. Zu den wichtigsten Reformpunkten werden genannt:
- Löschung erledigter Einträge nach 18 statt 36 Monaten (genannt wird auch die „100-Tage-Regel“ in Klammern).
- Wohnort und häufige Umzüge dürfen nicht mehr für die Score-Berechnung verwendet werden.
- Verbot der Nutzung von Social-Media-Daten.
- Stärkere Kontrolle durch Datenschutzaufsichtsbehörden.
Kritiker merken jedoch an, dass echte Kontrolle unmöglich bleibt, solange die Rechenmodelle geheim sind.
Wichtige Gerichtsurteile in 2025 und ihre Auswirkungen
Mehrere Gerichtsentscheidungen im Jahr 2025 haben und werden voraussichtlich weiterhin die Rechtslage beeinflussen:
- Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 10.04.2025 – 15 U 249/24):
- Das OLG Köln urteilte, dass die Beklagte (Schufa Holding AG) gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen hat, indem sie Einträge über Zahlungsstörungen auch nach Ausgleich der Forderungen über einen längeren Zeitraum gespeichert und zur Verfügung gestellt hat.
- Die fortwährende Speicherung erledigter Forderungen war rechtswidrig, da die Bedingungen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO nicht mehr erfüllt waren. Insbesondere die Bedingung des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO war nicht erfüllt.
- Bei der erforderlichen Abwägung der Interessen ist mangels gesetzlicher Regelung der Speicherfristen für Wirtschaftsauskunfteien die gesetzliche Wertung des § 882e Abs. 3 Nr. 1 ZPO maßgeblich zu berücksichtigen. Danach wird eine Eintragung im Schuldnerverzeichnis gelöscht, wenn dem zentralen Vollstreckungsgericht die vollständige Befriedigung des Gläubigers nachgewiesen wurde.
- Unter Berücksichtigung dieser Wertung hätte die Beklagte die Einträge über Zahlungsstörungen löschen müssen, nachdem ihr die vollständige Befriedigung der Gläubiger nachgewiesen worden war.
- Das Gericht überträgt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 7. Dezember 2023 (C-26/22) zur Speicherdauer von Restschuldbefreiungsdaten auch auf Einträge im Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO). Der Zweck, die erneute Beteiligung am Wirtschaftsleben zu ermöglichen, gilt ebenso für Schuldner im Schuldnerverzeichnis nach Befriedigung der Gläubiger und Löschung des Eintrags.
- Die genehmigten Verhaltensregeln für Speicherfristen von Wirtschaftsauskunfteien vom 25. Mai 2024, die eine Speicherung von ausgeglichenen Forderungen für bestimmte Zeiträume (seit 1. Januar 2025 unter bestimmten Voraussetzungen 18 Monate) erlauben, sind laut OLG Köln für die Abwägung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO unerheblich. Die Beklagte konnte sich nicht auf die Richtigkeit dieser Regeln verlassen.
- Dem Kläger entstand ein immaterieller Schaden in Form einer Rufschädigung. Dies resultierte daraus, dass die Beklagte Scorewerte und Erfüllungswahrscheinlichkeiten, die unter Berücksichtigung der rechtswidrig gespeicherten Zahlungsstörungen ermittelt wurden, an Vertragspartner (Banken, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen) übermittelte. Dies wirkte sich abträglich auf den sozialen Geltungsanspruch des Klägers aus.
- Der immaterielle Schaden wurde mit 500 € bemessen. Nach der neueren Rechtsprechung des EuGH und BGH erfüllt der Schadensersatzanspruch aus Art. 82 Abs. 1 DSGVO ausschließlich eine Ausgleichsfunktion, keine Abschreckungs- oder Straffunktion. Die Schwere des Verstoßes oder ein Verschulden beeinflussen die Schadenshöhe nicht.
- Die Beklagte war zum Zeitpunkt der Klageerhebung im November 2023 zur Löschung der Einträge nach Art. 17 Abs. 1 Buchstaben a, d DSGVO verpflichtet.
- Bundesgerichtshof (Urteil vom 28.01.2025 – VI ZR 183/22):
- Der BGH bestätigte im Ergebnis eine Entscheidung des OLG Koblenz, bemängelte aber die Argumentation zur Bemessung des immateriellen Schadensersatzes nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO.
- Der Schadensersatz hat demnach ausschließlich eine Ausgleichsfunktion, keine Abschreckungs- oder Straffunktion.
- Weder die Schwere des Verstoßes noch schuldhaftes Handeln werden bei der Bemessung des immateriellen Schadens berücksichtigt.
- Landgericht Traunstein (Endurteil vom 14.02.2025 – AZ.: 6 0 1888/24):
- Das Gericht verurteilte die Beklagte (Schufa Holding AG) zur Löschung eines Eintrags über die Erledigung einer früheren Forderung vom 26.04.2023 (mit Erledigungsdatum 10. März 2022) und aller damit zusammenhängenden Einträge.
- Dem Kläger stand ein Löschungsanspruch gemäß Art. 17 DSGVO zu.
- Amtsgericht München (Urteil vom 21.01.2025 – Az.: 274 C 21110/24):
- Das Gericht verurteilte die Schufa Holding AG zur Löschung eines Negativeintrages, da nicht nachweislich alle Meldevoraussetzungen vorlagen.
- Es stellte fest, dass die Forderung weder unstreitig noch erwiesen war und die notwendige qualifizierte Mahnung mit Rückstandsaufstellung und Zahlungsfrist unter Androhung der Kündigung nicht nachgewiesen wurde.
- Das Gericht stellte fest, dass die Schufa die Beweislast trägt, wenn es um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung geht.
- Weitere Gerichtsentscheidungen in 2025: Quellen zitieren weitere Beschlüsse und Urteile von Oberlandesgerichten in München, Koblenz und Stuttgart sowie dem Landgericht Berlin II aus den ersten Monaten des Jahres 2025, was auf eine fortlaufende rechtliche Auseinandersetzung mit diesen Themen hindeutet. Das OLG Hamburg hat ebenfalls seine Rechtsprechung zu Schadensersatz nach Schufa-Einträgen konkretisiert, was in einer Publikation vom 13.02.2025 diskutiert wird.
Kernpunkte der Rechtslage in 2025
- Die Speicherung von Daten über erledigte Forderungen durch Wirtschaftsauskunfteien unterliegt strengeren Anforderungen.
- Nach der gesetzlichen Wertung des § 882e Abs. 3 Nr. 1 ZPO müssen Einträge über Zahlungsstörungen gelöscht werden, sobald die vollständige Befriedigung des Gläubigers nachgewiesen ist.
- Die Speicherdauer darf nach EuGH-Rechtsprechung und deren Anwendung durch deutsche Gerichte nicht länger sein als die Speicherdauer in öffentlichen Registern wie dem Schuldnerverzeichnis.
- Die seit 1. Januar 2025 geltenden Regeln (genehmigt im Mai 2024), die 18 Monate Speicherdauer für erledigte Forderungen vorsehen, sind für die rechtliche Abwägung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO unerheblich.
- Unrechtmäßige Speicherung und Übermittlung von Daten kann zu einem Anspruch auf immateriellen Schadensersatz wegen Rufschädigung führen. Dieser Schadensersatz dient dem Ausgleich des erlittenen Schadens.
- Die Voraussetzungen für einen Negativeintrag (§ 31 BDSG a.F. / Art. 6, 17 DSGVO) müssen strikt eingehalten werden (z.B. Forderung unbestritten, ausreichende Mahnungen). Bei Nichteinhaltung kann ein Löschungsanspruch bestehen.
- Auch die Weitergabe von „Positivdaten“ (z.B. durch Mobilfunkanbieter) ohne ausreichende Rechtsgrundlage verstößt gegen die DSGVO und kann Schadensersatzansprüche begründen.
- Die Drohung mit einem Schufa-Eintrag, insbesondere bei bestrittenen Forderungen oder wenn die Voraussetzungen für eine Meldung nicht erfüllt sind, kann unzulässig oder sogar strafbar sein.
Was Verbraucher tun sollten (Stand 2025):
- Einmal jährlich die kostenlose Selbstauskunft anfordern (Art. 15 DSGVO).
- Einträge genau prüfen, insbesondere auf veraltete oder doppelte Informationen.
- Bei Unklarheiten rechtlichen Rat einholen.
- Scoring-Apps kritisch hinterfragen.
- Aktiv Widerspruch einlegen, anstatt Einträge einfach hinzunehmen.
- Ein negative Eintrag sollte anwaltlich überprüft werden, insbesondere wenn eine vorzeitige Löschung gewünscht ist, da Fehler bei den einmeldenden Stellen zur Löschung führen können.
Seit vielen Jahren unterstützen wir Mandanten erfolgreich bei der Bewältigung von Schufa-Problemen. Unsere Expertise hilft Ihnen, Ihre finanzielle Reputation wiederherzustellen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:
Die Kanzlei Dr. Thomas Schulte ist Vertrauensanwalt des Netzwerks ABOWI LAW und Mitglied der ASSOCIATION OF EUROPEAN ATTORNEYS.
- E-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de
- Telefon: +49 (0) 30 – 22 19 220 20
SCHUFA & Datenschutz
-
Löschfristen-Chaos bei der SCHUFA
Analyse des OLG Köln-Urteils zur sofortigen Löschung erledigter EinträgeDr. Thomas Schulte Berlin+1Advocado+1 -
Bahnbrechendes Urteil: OLG Köln kippt 3-Jahresfrist für SCHUFA-Einträge
Meilenstein für Verbraucherrechte im DatenschutzDr. Thomas Schulte Berlin+1Dr. Thomas Schulte Berlin+1 -
Schufa-Eintrag löschen – Landgericht verlangt vernünftige Kontrolle
LG Traunstein stärkt Verbraucherrechte bei SCHUFA-EinträgenDr. Thomas Schulte Berlin -
Unzulässige Schufa-Meldung: 500 Euro Schadensersatz wegen Datenweitergabe
Urteil des LG Mainz zur unrechtmäßigen DatenweitergabeDr. Thomas Schulte Berlin+1Dr. Thomas Schulte Berlin+1 -
Schufa-Scoring: Die geheime Formel, die über Ihr Leben entscheidet
Einblick in die Auswirkungen des SCHUFA-Scores auf VerbraucherDr. Thomas Schulte Berlin