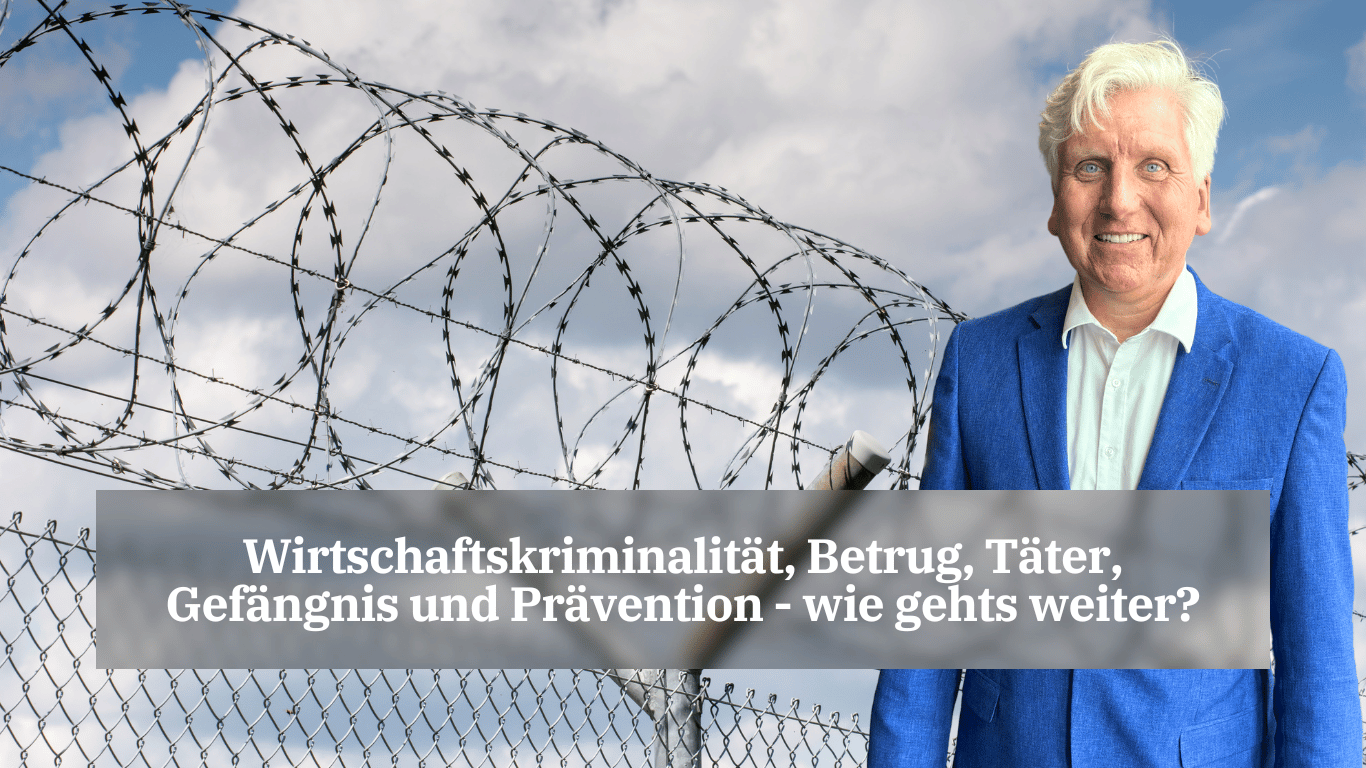Im Arbeitskreis Wirtschaftskriminalität und Opferschutz werden aktuelle Themen, die in dem von Dr. Thomas Schulte und Carsten Beyreuther gegründeten Arbeitskreis erarbeitet werden, kontrovers diskutiert. Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit Lösungen zu den Themen Wirtschaftskriminalität und Opferschutz. Dieser Beitrag von 2012 beleuchtet die Ergebnisse der DIskussion.
Dabei wird vor allem nicht nur deren Bekämpfung sondern deren Verhinderung von der ersten Stufe an beleuchtet. Es geht um Ethik und Moral und praktische Lösungen für die Opfer.
Prävention von Wirtschaftskriminalität
Dr. Thomas Schulte: „Bis jetzt hat sich unser Arbeitskreis Wirtschaftskriminalität und Opferschutz viel mit der Bekämpfung beschäftigt. Bekämpfung zur Verhinderung ist das Thema. Dabei müssen wir das Problem von der Straftat selbst bis hin zur Entstehung des Problems analysieren. Wichtig ist es, sich in den Täter hineinzuversetzen und die Problemstellung analysieren. Handelt es sich um eine interne oder externe Problemstellung. Darunter fallen Alkohol- oder Drogenprobleme, Geldsorgen, Anerkennung, Leistungsdruck, Erfolgsmacht uvm. Das Augenmerk liegt nicht alleine direkt beim Täter, sondern auch das Umfeld des Täters trägt maßgeblich bewusst und unbewusst zum Handeln bei.“
Prävention
Carsten Beyreuther: „Das Stichwort ist Prävention, d.h. wir treffen vorbeugende Maßnahmen, um eben gerade nicht das unerwünschte Ereignis Wirtschaftskriminalität eintreten zu lassen. Im Rahmen des Strafrechts werden für die Strafe die Generalprävention und Spezialprävention als Rechtfertigungen herangezogen. Hierbei unterscheiden wir auf die Täter bezogene Prävention, Situationsbezogene und Opferbezogene Prävention. Dabei wird tertiäre Prävention unter den Aspekten Abschreckung, Besserung und Sicherung betrieben. Wir beschäftigen uns also um vorausschauende Problemvermeidung.
Dr. Thomas Schulte: „Aller Anfang ist klein, das Ungleichgewicht fängt oftmals in nicht wahrnehmbaren Strukturen an. Ein großes bekanntes Problem verdeutlicht diese These, die besagt, dass die Wertigkeit und das Wertgefühl die Motoren des Handelns sind. Studien zufolge betrifft es viele Arbeitnehmer, die sich als Opfer einer schlechten bzw. zu einseitig verlagerten Unternehmensphilosophie fühlen. Viele Unternehmen richten ihre Unternehmensphilosophie sehr stark auf den Kunden aus und vergessen die Stärkung des Mitarbeiters. Ein Ungleichgewicht entsteht, dabei bleibt einer auf der Strecke: Der Arbeitnehmer.“
Identifikation mit dem Unternehmen für mehr Produktivität und Zufriedenheit
Carsten Beyreuther: „Von dem Arbeitnehmer wird stets verlangt, dass er seinen Job richtig erledigen soll, soweit so gut – jenes ist ja auch im Arbeitsvertrag konstituiert. Darüber hinaus wird auch verlangt, er soll sich mit seinem Unternehmen gar identifizieren. Dazu gibt es erfolgreiche Unternehmensberatungen und Coachings. Oftmals ist der Wille da, doch die Realität sieht anders aus. Genügt es z.B., dass das Unternehmen mittels einer einmal im Jahr stattfindenden Weihnachtsfeier die Identifizierung des Arbeitnehmers mit dem Unternehmen erlangt? Folgende Philosophie wäre erstrebenswert: Lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. (Lebensmotto von Mutter Theresa)
Dr. Thomas Schulte: „Nehmen wir einmal den universitären Vergleich von Deutschland und den USA. In Deutschland wird die Universität vom Studenten zumeist lediglich als Lehrstätte verstanden. In den USA hingegen ist eine Universität mehr als nur das, es ist ein Ort, an dem Freizeitgestaltung, Hobbys und Interessen vereint werden. Deshalb fällt eben eine solche Identifikation eines amerikanischen Studenten mit seiner Universität nicht schwer. Beispielsweise letzte Woche haben die beiden Footballmannschaften Harvard und Yale wieder eines ihrer berühmten Matches veranstaltet. Um die 10.000 Fans kamen in hauseigener Mode zum dem Spiel. Hierzulande schreibt der Spiegel über den „dramatischen Zusammenprall der Edel-Unis[1].“
Carsten Beyreuther: „Die These bedeutet: Wer sich mit seinem Unternehmen besser identifiziert, der läuft weniger Gefahr, Wirtschaftskriminalität gerade dort zu vollziehen. Viele Unternehmen fühlen sich davon nicht betroffen. Dabei sind besonders häufig auch mittelständische Unternehmen betroffen und wer denkt, das Wirtschaftskriminalität im eigenen Unternehmen nur auf der Chefetage passiert, der liegt falsch[2]. Wirtschaftskriminalität passiert heutzutage auf allen Unternehmensetagen; Praktikanten, Vorstandsmitglieder, Buchhalter oder Reinigungspersonal.“
Besserung der Unternehmensstruktur als Obliegenheit
Dr. Thomas Schulte: „Wir möchten keinesfalls einen Eingriff in die Privatwirtschaft vornehmen. Es ist wichtig, das die Unternehmen die Verbesserung ihrer Unternehmensstruktur als Obliegenheit verstehen, nicht als einen Eingriff. Verbesserung der Unternehmensstruktur heißt: Möglichkeiten schaffen, damit der zukünftige Wirtschaftskriminelle eine solche Tat gegen sein eigenes Unternehmen nicht begeht. Das Problem wird also auf einer ganz anderen Stufe angegangen, nämlich auf jener Stufe, auf der eine Verhinderung noch am wahrscheinlichsten ist.“
Carsten Beyreuther: „Dabei wären wir auch wieder bei dem Thema Wirtschaft und Ethik. Es ist wichtig, dass das Unternehmen hierbei nicht nur auf die Erreichung von bestimmten Umsätzen fixiert ist. Eine Fokussierung auch auf die Arbeitnehmer und deren Identifikation mit dem Unternehmen hat langfristig gesehen mehr Erfolg, als eine kurzfristige Fixierung auf Umsätze. Ethik ist dabei einer dieser Grundsätze. Das Unternehmen muss also zwangsläufig ethisch denken; diese Maßnahme hat zudem auch Synergieeffekte nicht nur bezüglich der Arbeitnehmer, auch Kunden profitieren von der besseren Unternehmensstruktur.“
Integrationsprävention
Dr. Thomas Schulte: „Auch in der Jurisprudenz gilt dieses Prinzip – allerdings etwas abgewandelt – seit nunmehr 40 Jahren. 1969 kam der Begriff „Verteidigung der Rechtsordnung“ in das Strafgesetzbuch. Dabei beschäftigt sich die Rechtsprechung mit dem Zweck von Strafe. Bei der sogenannten Integrationsprävention ist der Zweck der Strafe die Verteidigung bzw. Stärkung der Rechtsordnung. Durch Strafe erreicht man die Aufrechterhaltung des Rechtsbewusstseins der Bürger. Dadurch erfährt die Rechtsordnung eine Stärkung, sie wird also verteidigt. Durch unsere Überlegungen stärken wir den Zusammenhalt des Unternehmens. Wichtig ist, dass sich der Arbeitnehmer durch Ethik, Arbeitnehmerfreundlichkeit besser mit seinem Unternehmen identifizieren kann. Dadurch wird das Bewusstsein gestärkt, das der Wirtschaftskriminelle eine Tat begeht, die ihm selbst Schaden zufügt.
Der Arbeitskreis wird sich weiter mit den Belangen des Opferschutzes in der Wirtschaftskriminalität beschäftigen und in Seminarreihen das erworbene Wissen an Dritte weitergeben. Wirtschaftskriminalität muss dort verhindert werden, wo das Opfer noch keines ist.
Prävention von Wirtschaftskriminalität und Opferschutz – ein Update
Wirtschaftskriminalität – also wirtschaftsbezogene Straftaten wie Betrug, Korruption, Untreue oder Bilanzdelikte – verursachen jährlich enorme Schäden und belasten das Vertrauen in die Wirtschaft. Allein 2022 wurden in Deutschland über 73.000 Wirtschaftsdelikte polizeilich erfasst, mit einem Gesamtschaden von rund 2,1 Milliarden Euro. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass jedes dritte Unternehmen 2023 von Wirtschaftskriminalität betroffen war – der höchste Wert seit 2014. International liegt der Anteil sogar bei 46 %. Die Dunkelziffer ist hoch, Experten schätzen sie teils auf ein Mehrfaches der bekannten Fälle. Diese Zahlen sind alarmierend und machen deutlich: Vorbeugung und Opferschutz sind dringender denn je.
Doch wie können Unternehmen sich wirksam vor Wirtschaftskriminalität schützen, und wie lassen sich Opfer besser unterstützen? Ein von Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte und Verkaufstrainer Carsten Beyreuther gegründeter Arbeitskreis sucht seit einigen Jahren nach Antworten. Im Mittelpunkt stehen dabei Strategien wie eine ethische Unternehmensführung, Täterprävention, Mitarbeitermotivation und „Integrationsprävention“ – also die Reintegration straffällig gewordener Personen, um Rückfälle zu verhindern. Dieser Artikel beleuchtet aktuelle Entwicklungen, bewährte Maßnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen, um Wirtschaftskriminalität proaktiv entgegenzutreten und Opfer zu schützen.
Wirtschaftskriminalität: Aktuelle Zahlen und Trends
Wirtschaftskriminalität nimmt in ihrer Komplexität und technischen Raffinesse zu. Cyberkriminalität ist mittlerweile das häufigste Wirtschaftsdelikt: 55 % der deutschen Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Erfahrungen mit Cyberangriffen und digitalem Betrug gemacht. Ebenso bleibt Korruption ein großes Problem – 34 % der Unternehmen berichten von Bestechungs- oder Bestechlichkeitsvorfällen. Laut Bundeskriminalamt zählen auch Anlage- und Finanzbetrug, Insolvenzdelikte, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu den gängigen Formen. Die Polizei ordnet dabei Fälle von erheblicher finanzieller Schadenshöhe oder mit vielen Geschädigten als „Wirtschaftskriminalität“ ein (gemäß § 74c Gerichtsverfassungsgesetz).
Erfreulich ist die hohe Aufklärungsquote bekannter Fälle von fast 92 % (2022). Dass so viele Taten aufgeklärt werden, liegt auch daran, dass die Täter in Unternehmen oft bekannt sind – Schätzungen zufolge stammt jeder zweite Wirtschaftsstraftäter aus den eigenen Reihen des geschädigten Unternehmens. Häufig sind es langjährige, gut ausgebildete Mitarbeiter in Führungspositionen, die wirtschaftskriminelle Handlungen begehen. Der typische Wirtschaftskriminelle ist männlich, um die 40 Jahre alt, akademisch gebildet und karriereorientiert – Eigenschaften, die im Berufsleben durchaus geschätzt werden. Umso wichtiger ist es, frühzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen und ein Unternehmensumfeld zu schaffen, das Taten gar nicht erst entstehen lässt.
Gleichzeitig darf man sich von hohen Aufklärungsquoten nicht in Sicherheit wiegen. Viele Delikte werden gar nicht erst bekannt. Aus Angst vor Reputationsschäden oder in der Annahme, ohnehin keinen Schadenersatz zu erhalten, verzichten Unternehmen häufig auf Strafanzeigen. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle von Betrug, Bestechung oder Veruntreuung ist erheblich, was darauf hindeutet, dass die tatsächlichen Schäden noch weit höher liegen. So schätzt das IW, dass praktisch jedes Jahr 4,7 bis 7,1 % des Umsatzes durch Korruption, Kartelle oder Schwarzarbeit verloren gehen – ein immenser volkswirtschaftlicher Schaden.
Der Trend der letzten Jahre zeigt ein ambivalentes Bild: In der polizeilichen Kriminalstatistik stieg die Zahl der erfassten Wirtschaftsdelikte bis 2022 drei Jahre in Folge. 2023 gab es ersten Meldungen zufolge einen Rückgang, was allerdings teils auf Ausreißerfälle im Vorjahr zurückzuführen ist. Klar erkennbar ist jedoch, dass Internet- und IT-Bezug in fast allen Deliktbereichen zunimmt – vom Online-Banking-Betrug bis zum Hackerangriff auf Unternehmensdaten. Zudem haben globale Krisen neue Tatgelegenheiten geschaffen, etwa Betrug mit Corona-Hilfsgeldern oder Umgehung von Sanktionen. Unternehmen sehen sich also einer dynamischen Bedrohungslage ausgesetzt, die laufend Anpassung erfordert.
Ethische Unternehmensführung und Compliance als Prävention
Ein zentraler Ansatz zur Prävention von Wirtschaftskriminalität ist eine werteorientierte Unternehmensführung und konsequente Compliance. “Risiken frühzeitig zu erkennen und intelligent zu managen ist entscheidend für die Reputation und den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Organisationen, die beim Thema Wirtschaftskriminalität vorausschauend und proaktiv handeln, sind besser für die Herausforderungen von morgen vorbereitet,” betont Arndt Engelmann, Forensic-Experte bei PwC. Konkret bedeutet das: Unternehmen müssen klare Wertemanagement-Systeme etablieren, die Integrität und Transparenz fördern. Studien des IW und von PwC empfehlen etwa, Verhaltenskodizes regelmäßig in Erinnerung zu rufen, Führungskräfte als Vorbilder einzusetzen und Anlaufstellen für Compliance-Fragen und Hinweisgeber zu schaffen.
Moderne Compliance-Management-Systeme (CMS) gehen weit über bloße Pflichterfüllung hinaus. Sie umfassen präventive Maßnahmen wie interne Kontrollen, Vier-Augen-Prinzip, regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, und sichere Hinweisgebersysteme. Seit 2023 verlangt sogar das Gesetz (Hinweisgeberschutzgesetz) von mittleren und großen Unternehmen, interne Meldestellen für Whistleblower einzurichten. Das ist kein bürokratischer Selbstzweck: Hinweisgebersysteme gelten seit langem als essentieller Bestandteil effektiver Compliance-Programme, um Wirtschaftskriminalität einzudämmen. Mitarbeiter müssen Missstände vertraulich melden können, ohne Repressalien befürchten zu müssen. So können Fehlverhalten frühzeitig aufgedeckt und Schäden begrenzt werden.
Best Practices zeigen, dass Unternehmen erfolgreich sind, wenn Compliance als Teil der Unternehmenskultur verankert wird. Wichtig ist der “Tone from the Top” – das klare Bekenntnis der Geschäftsleitung zu ethischem Verhalten. Die Belegschaft orientiert sich an den Führungskräften: Werden Regeln an der Spitze umgangen, färbt das ab. Umgekehrt schaffen vorbildliche Chefs ein Klima, in dem Integrität honoriert wird. Compliance ist mehr als Regelwerke, es geht um Vertrauen: Unternehmen, die transparente und robuste Compliance-Strategien umsetzen, erfüllen nicht nur rechtliche Vorgaben – sie stärken auch das Vertrauen von Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Dieses Vertrauen ist ein Wettbewerbsvorteil.
Auch technisch rüsten viele Firmen auf. 68 % der deutschen Unternehmen nutzen laut PwC inzwischen umfangreiche Risikoanalysen zur Betrugsprävention. Mit Datenanalysen, KI-Tools und automatisierten Monitoring-Systemen lassen sich verdächtige Muster oder Anomalien frühzeitig erkennen – sei es bei Transaktionen, Zugriffsprotokollen oder Geschäftspartnern. Besonders im Finanzsektor gehören solche Technologien mittlerweile zum Standard (Stichwort Fraud Detection). Zudem gewinnen Lieferketten-Integrität und Sanktions-Compliance an Bedeutung, gerade vor dem Hintergrund internationaler Sanktionen und Exportkontrollen. Unternehmen, die hier proaktiv agieren, schützen sich vor bösen Überraschungen.
Nicht zuletzt hat die Rechtsentwicklung einen Anreiz gesetzt: Zwar gibt es in Deutschland (noch) kein eigenständiges Unternehmensstrafrecht, aber die Diskussion um schärfere Unternehmenssanktionen läuft. Schon jetzt können bei Regelverstößen gegen Unternehmen Bußgelder bis 10 Mio. € verhängt werden (§ 30 OWiG) – Tendenz steigend. Compliance lohnt sich daher auch finanziell: In einem aktuellen Beschluss der Justizministerkonferenz wurde betont, dass das geltende Recht zur Unternehmenssanktionierung erweitert werden sollte. Unternehmen sind gut beraten, ein Compliance-Management-System einzurichten und ständig weiterzuentwickeln, da sich so die Verhängung hoher Geldbußen vermeiden oder zumindest deutlich reduzieren lässt. Mit anderen Worten: Prävention ist die beste Versicherung gegen rechtliche und finanzielle Folgen.
Täterprävention: Motive verstehen und Taten vorbeugen
Wirtschaftskriminalität wird nicht von „klassischen Verbrechern“ begangen, sondern häufig von Personen, die im normalen Leben unauffällig sind. Warum werden loyale Mitarbeiter oder angesehene Manager zu Tätern? Die Motive sind vielfältig: Persönliche Krisen, Leistungsdruck, Geltungsdrang, finanzielle Engpässe oder auch schlichte Gelegenheit. Oft spielt die Psychologie eine große Rolle – etwa das Ausnutzen von Grauzonen und das Schönreden des eigenen Fehlverhaltens (Rationalisierung). „Auch Betrüger können erfolgreich sein! Es gibt nicht nur schwarz oder weiß… Die Motivation reicht über eine ganze Farbpalette und manchmal fühlt es sich nur ein klein wenig betrügerisch an“, beschreibt Carsten Beyreuther anschaulich die schleichende Grenzüberschreitung im Geschäftsleben. Was als kleiner Regelverstoß beginnt, kann sich zu einer kriminellen Spirale entwickeln, aus der man kaum mehr herausfindet.
Ein präventiver Ansatz besteht darin, diese Ursachen an der Wurzel zu packen. Unternehmen sollten ein Auge auf Warnsignale haben – z.B. Mitarbeiter mit plötzlich exorbitantem Lebensstil, mit auffälligen Zugriffsrechten oder solche, die unter großem Druck stehen. Aber Kontrolle alleine ist kein Allheilmittel: „Gelegenheit allein macht noch keine Diebe“, heißt es treffend. Ein Zuviel an Misstrauenskultur kann sogar kontraproduktiv sein und ehrliche Mitarbeiter demotivieren. Viel wichtiger ist es, ein offenes Betriebsklima und faires Miteinander zu fördern. Wer sich vom Unternehmen wertgeschätzt fühlt und Probleme offen ansprechen kann, hat weniger Anlass, illoyal zu handeln.
Studien zeigen, dass unternehmensinterne Täter oft schon lange in der Firma sind (durchschnittlich 8 Jahre) und sich stark mit ihr identifizieren, bis es zu einem Bruch kommt. Häufig kommen mehrere Faktoren zusammen: persönliche Frustration über Karrierewege, wahrgenommene Ungerechtigkeit, das Gefühl, die eigenen Ziele nicht legal erreichen zu können – gepaart mit einer ersten erfolgreichen „Abkürzung“ über unerlaubte Mittel. Sobald der erste illegale Erfolg da ist, steigt die Hemmschwelle, zurück zur Rechtschaffenheit zu finden (der „Point of no Return“ ist überschritten). Prävention bedeutet hier, solchen Entwicklungen zuvorzukommen. Praktisch heißt das: realistische Ziele setzen, Überlastung vermeiden, Erfolge auf legalem Wege honorieren, und ein offenes Ohr für persönliche Sorgen haben.
Täterprävention beginnt somit beim Führungsstil und der Unternehmenskultur. Transparente Entscheidungen, gerechte Vergütung und Beteiligung der Mitarbeiter an Verbesserungen können das Wir-Gefühl stärken. Einige Unternehmen setzen auf Rotationsprinzipien oder Urlaubspflichten, um Insider-Manipulation zu erschweren – wer regelmäßig die Position wechselt oder seine Vertretung einarbeiten muss, kann schwerer verdeckte Machenschaften aufrechterhalten. Auch Screening bei sensiblen Positionen (z.B. Finanzabteilungen) und 4-Augen-Freigaben für kritische Transaktionen reduzieren das Risiko, dass Einzelpersonen unbemerkt Straftaten begehen können. Letztlich gilt: eine Kombination aus Vertrauen und Kontrolle ist entscheidend – sowie das Verständnis, dass Prävention nicht nur Technik und Vorschriften bedeutet, sondern vor allem den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Mitarbeitermotivation und Integritätskultur
Eng verknüpft mit Täterprävention ist die Motivation der Mitarbeiter, integer zu handeln. Viele Wirtschaftsstraftaten im Unternehmen passieren, weil Mitarbeiter das Gefühl haben, kein Schaden zu verursachen – oder sogar meinen, im Interesse der Firma zu handeln (z.B. durch kreative Buchführung zur „Erfolgssicherung“). Dem lässt sich entgegenwirken, indem man Integrität zur Selbstverständlichkeit macht. Integritätskultur bedeutet: Alle im Unternehmen – vom Azubi bis zum Vorstand – wissen um die Werte des Hauses, und es wird erwartet und honoriert, danach zu handeln.
Schulung und Sensibilisierung sind hier zentrale Stichworte. Regelmäßige Trainings zu Themen wie Betrugserkennung, Datenschutz, Korruptionsverbot oder Kartellrecht machen Mitarbeitern klar, wo Gefahren lauern und wie sie sich verhalten sollen. Wichtig ist, diese Inhalte lebendig zu vermitteln, etwa durch Praxisfälle oder E-Learning mit interaktiven Szenarien. So verstehen Beschäftigte, welche Konsequenzen Fehlverhalten haben kann – für das Unternehmen, die Opfer und sie selbst. Viele lassen sich ansonsten von scheinbar harmlosen Gelegenheiten verführen, weil sie das Unrechtsbewusstsein verlieren oder meinen, „alle machen das so“. Hier muss Gegensteuern erfolgen: Eine klare Null-Toleranz-Politik bei Regelverstößen, verbunden mit transparenter Kommunikation, zeigt, dass es der Firma ernst ist.
Die Mitarbeitermotivation, ehrlich und loyal zu bleiben, hängt auch von Anreizsystemen ab. Werden ausschließlich Umsatz und kurzfristige Ziele belohnt, steigt die Gefahr, dass Beschäftigte illegale Abkürzungen nehmen, um die Erwartungen zu erfüllen. Vorbildlich sind Unternehmen, die Compliance-Ziele in ihre Bonus- und Bewertungssysteme integrieren. Zum Beispiel kann ein Manager nur dann seinen vollen Bonus erhalten, wenn zugleich keine Compliance-Verstöße in seinem Verantwortungsbereich auftreten. Auch Team-Belohnungen für gute Prüfungsergebnisse (etwa bei internen Audits) oder Auszeichnungen für Hinweisgeber signalieren: Redliches Verhalten zahlt sich aus.
Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung der Belegschaft in Präventionsmaßnahmen. Mitarbeiter an der Basis wissen oft am besten, wo die Schwachstellen liegen. Firmen können z.B. Workshops oder anonyme Umfragen durchführen, um von ihren Leuten zu erfahren, wo es brennt – sei es ein überbürokratischer Prozess, der Umgehungen fördert, oder ein bestimmter Bereich mit hohem Druck. Wer seine Mitarbeiter ernst nimmt und in Lösungen einbezieht, fördert die Loyalität. Das Motto lautet: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“ – wertschätzende Behandlung und Fairness reduzieren den Nährboden für kriminelles Verhalten.
Nicht zuletzt sollten Unternehmen die Erfolgsgeschichten von Integrität kommunizieren. Wenn etwa ein Mitarbeiter durch Zivilcourage einen Betrug vereitelt oder ein Team dank guter Compliance-Praktiken einen riskanten Geschäftspartner identifiziert hat, gehört das gewürdigt und intern bekanntgemacht. Positive Beispiele schaffen Nachahmer. Führungskräfte tragen hier besondere Verantwortung: durch aktives Vorleben der Regeln und Offenheit für Kritik. Mitarbeiter müssen spüren, dass Chefs lieber ehrliche Diskussionen führen als durch falsche Zahlen glänzen. Diese gelebte Kultur der Aufrichtigkeit ist einer der wirksamsten Schutzmechanismen gegen Wirtschaftskriminalität.
Opferschutz und „Integrationsprävention“: Täter und Opfer im Fokus
Während Prävention idealerweise Straftaten verhindert, lässt sich ein Restrisiko nie ausschließen. Umso wichtiger sind der Schutz der Opfer und die Rehabilitation der Täter – zwei Seiten, die der Arbeitskreis „Wirtschaftskriminalität und Opferschutz“ gezielt zusammenführt. Die Realität für Opfer von Wirtschaftskriminalität ist oft bitter: Selbst wenn der Täter gefasst und verurteilt wird, sehen die Geschädigten ihr Geld selten wieder. Dr. Thomas Schulte erklärt: Gewinnt ein Betrugsopfer vor Gericht, bedeutet das längst nicht, dass der zugesprochene Schadenersatz auch fließt – viele Täter können die hohen Summen gar nicht begleichen. Die staatlichen Stellen versagen hier bislang häufig, echte Wiedergutmachung zu schaffen. Opferschutz heißt daher nicht nur juristische Aufarbeitung, sondern vor allem: Wie bekommt das Opfer zumindest einen Teil seines Verlustes ersetzt und wie verarbeitet es das Geschehene?
Ein Ansatz, den der Arbeitskreis verfolgt, ist die Wirtschaftsmediation – also die Vermittlung zwischen Täter und Opfer. “Keinem – weder Opfer noch Täter – ist geholfen, den Täter lediglich auf die justizielle Schlachtbank zu schicken”, so Dr. Schulte. Oft endet ein Strafprozess mit einer Haftstrafe, aber das Opfer hat finanziell nichts davon und der Täter verlässt das Gefängnis ohne Einsicht. Durch eine strukturierte Mediation hingegen kann erreicht werden, dass der Täter Verantwortung übernimmt und aktiv an der Wiedergutmachung mitwirkt. Diese direkte Konfrontation in einem geschützten Rahmen – moderiert von erfahrenen Mediatoren – hilft beiden Seiten: Das Opfer bekommt Genugtuung und eventuell Teilzahlungen, der Täter erfährt die Folgen seines Handelns unmittelbar und kann sich persönlich entschuldigen. Solche restorative justice-Ansätze werden international bereits erfolgreich erprobt und verdienen auch in Wirtschaftsstrafverfahren mehr Beachtung.
Integrationsprävention bedeutet in diesem Kontext, straffällig gewordenen Personen eine Chance zur Reintegration zu geben, um weitere Taten zu verhindern. Unser Strafrecht verfolgt neben der Abschreckung (Generalprävention) immer auch den Zweck der Resozialisierung (Spezialprävention). Doch gerade bei Wirtschaftskriminellen greift das System oft zu kurz. Die Haftstrafe isoliert den Täter zunächst und schützt die Allgemeinheit – doch nach der Entlassung ist der Ex-Manager oder Finanzbetrüger „gebrandmarkt“ und steht vor einem Scherbenhaufen. Einen Job zu finden ist mit Vorstrafe extrem schwer, zugleich bleibt der soziale Umgang wegen des Stigmas erschwert. Diese soziale Isolation nach der Strafe erhöht die Gefahr eines Rückfalls – der Täter fühlt sich ausgeschlossen und sieht womöglich keinen Weg zurück in ein redliches Berufsleben.
Hier setzt die Idee an, Täter nach Verbüßung der Strafe gezielt dabei zu unterstützen, ein Leben ohne neue Straftaten zu führen. Das kann durch Mentoring-Programme, Therapie und vor allem durch einen Zugang zu legaler Beschäftigung geschehen. Natürlich darf das Opfer dabei nicht vergessen werden – im Gegenteil: Durch eine täterspezifische Ausrichtung des Opferschutzes kann dem Opfer sogar effektiver geholfen werden. Carsten Beyreuther betont, dass man die Erfahrungen und das Know-how ehemaliger Wirtschaftsstraftäter nutzen könnte, um neue Betrugsmaschen aufzuklären und Geschädigte zu unterstützen. So wird der Täter im Idealfall vom Schadenverursacher zum Teil der Lösung – „letztendlich ist der Täter Helfer und Geholfenem zugleich“. Dieses unkonventionelle Modell erzeugt Synergieeffekte: Der Ex-Täter leistet Wiedergutmachung und erhält gleichzeitig die Möglichkeit, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Natürlich bedarf es hierbei sorgfältiger Abwägung und Betreuung. Nicht jeder Verurteilte eignet sich als „geläuterter Helfer“, und für Opfer ist der direkte Kontakt auch nicht immer zumutbar. Dennoch lohnt es sich, solche innovativen Wege im Opferschutz zu prüfen. Schließlich steht am Ende das gemeinsame Ziel: Weniger neue Taten und ein Ende des Täter-Opfer-Teufelskreises. Wenn ein Betrüger seine Schuld einsieht, aktiv beim Schadenersatz hilft und wieder Teil der Gesellschaft wird, ist allen gedient – dem Opfer, der Allgemeinheit und auch dem Täter selbst.
Für Opfer von aktuellen Betrugsfällen gibt es zudem rechtliche Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. So können Geschädigte sich etwa einem Strafverfahren als Nebenkläger anschließen oder im Zivilprozess Ansprüche geltend machen. Auch die Zivilgerichte und Verbraucherrechte entwickeln sich weiter: Banken zum Beispiel können heute eher in die Haftung genommen werden, wenn Kunden durch Online-Betrug Geld verlieren. (Siehe unseren Ratgeber-Artikel „Bankhaftung bei Betrug: 5 Urteile – so sichern Sie Ihr Geld sofort“ auf unserer Website.) Dort wird erläutert, unter welchen Umständen Banken gestohlenes Geld ersetzen müssen – ein wichtiger Aspekt des Opferschutzes in der digitalen Welt. Generell gilt: Opfer sollten nicht zögern, professionellen Rat einzuholen. Eine frühzeitige Beratung kann helfen, Ansprüche zu sichern und weitere Schäden – etwa durch Trauma oder falschen Umgang mit Beweismitteln – zu vermeiden.
Fazit: Ganzheitliche Strategie gegen Wirtschaftskriminalität
Wirtschaftskriminalität und ihr Schatten sind nur durch einen ganzheitlichen Ansatz einzudämmen. Prävention beginnt weit vor der eigentlichen Tat – mit einer Unternehmenskultur, die Ethik höher stellt als den schnellen Profit, mit wachsamen internen Prozessen und informierten Mitarbeitern. Aktuelle Zahlen belegen die Dringlichkeit: Die Bedrohungslage ist real und divers, vom Cyberangriff bis zum Bestechungsskandal. Doch ebenso zeigen Best Practices, dass Unternehmen kein hilfloses Opfer dieser Gefahr sein müssen. Wer proaktiv handelt – mit Compliance-Systemen, Mitarbeiterschulungen, klaren Werten und offenen Ohren – kann das Risiko erheblich senken.
Zugleich darf man die Opfer nicht vergessen. Sie brauchen Unterstützung, damit aus dem finanziellen Schaden kein lebenslanger Schicksalsschlag wird. Hier sind Politik, Justiz und Unternehmen gemeinsam gefragt, neue Wege zu gehen. Opferschutz bedeutet mehr als Strafen verhängen – es bedeutet Wiedergutmachung ermöglichen. Und manchmal heißt es auch, den Täter zurück ins Boot zu holen: wenn er seine Lehren gezogen hat, kann er dabei helfen, zukünftige Taten zu verhindern.
Für Unternehmen wie für die Gesellschaft lohnt es sich, in Prävention und Opferschutz zu investieren. Jeder Euro, der durch Betrug, Korruption oder Diebstahl nicht verloren geht, jede Karriere, die auf legalem Weg Erfolg findet, und jedes Opfer, dem Gerechtigkeit widerfährt, stärkt das Vertrauen in unsere Wirtschaft. Haben Sie Fragen zur Prävention von Wirtschaftskriminalität oder benötigen Sie Unterstützung bei Compliance-Maßnahmen und Opferschutz? Unsere Kanzlei steht Ihnen mit Expertise in Wirtschaftsstrafrecht und Anlegerschutz zur Seite – nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf, um sich beraten zu lassen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Wirtschaftskriminalität weniger Chancen hat und Opfer nicht alleine gelassen werden.
Interner Link: Bankhaftung bei Betrug: 5 Urteile – so sichern Sie Ihr Geld sofort (Blog-Artikel)